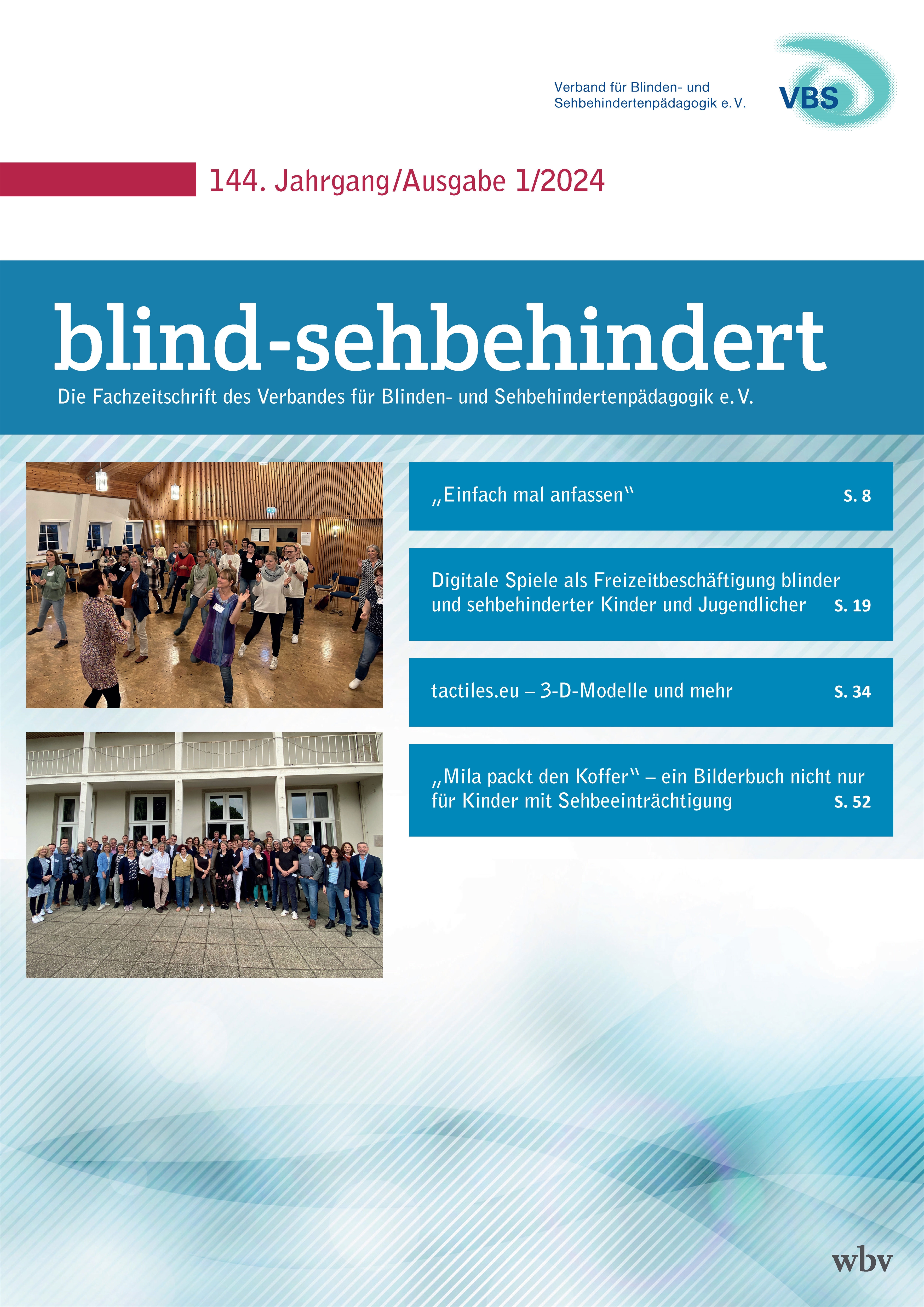Vortrag „Digitale Barrierefreiheit – Überblick zur Gestaltung von Dokumenten und rechtlichen Rahmenbedingungen“ auf der Landesversammlung
des VBS Niedersachsen und Bremen
Abstrakt
Der Beitrag zum Thema Digitale Barrierefreiheit gliedert sich in vier Bereiche. Zu Beginn erfolgen eine Skizzierung der Gruppe der Studierenden mit Beeinträchtigungen des Sehens und Blindheit und ein Kurzüberblick zum Stand der digitalen Barrierefreiheit an der Universität Hamburg. Im Hauptteil werden die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Grundlagen zur Gestaltung barrierefreier Dokumente erläutert. Als Fazit gilt, dass Barrierefreiheit von Anfang an als Querschnittsthema mitgedacht werden muss, um inklusive Strukturen zu schaffen.
Einstieg
Das Thema Digitalisierung hat seit der Coronapandemie stark an Bedeutung gewonnen. In diesem Kontext findet das Thema Barrierefreiheit häufig allerdings nur in geringem Maße Beachtung, hierdurch können Nachteile insbesondere für Personen mit Beeinträchtigung entstehen.
Die Gruppe der Studierenden mit Beeinträchtigungen, die sich erschwerend auf das Studium auswirken, ist in den letzten Jahren weiter gewachsenen. Laut der aktuellen 22. Sozialerhebung zählen sich 16 % aller befragten Studierenden zu dieser Gruppe (N = ca. 188.000). Davon geben 2 % die Kategorie „Beeinträchtigung des Sehens oder Blindheit“ an (Kultusministerkonferenz 1982; Kroher et al. 2023). Die Bedingungen für Studierende mit Beeinträchtigung des Sehens und Blindheit variieren dabei stark an unterschiedlichen Hochschulstandorten (Peschke & Gattermann-Kasper 2022, S. 292 f; Schütt & Gattermann-Kasper 2021, S. 296).
An der Universität Hamburg wird das Ziel der strukturellen Verankerung digitaler Barrierefreiheit verfolgt. Hierfür existiert ein regelmäßiger Jour fixe der Akteurinnen und Akteure, die explizit zur Thematik digitale Barrierefreiheit arbeiten. Exemplarisch sind folgende Serviceangebote und Strukturen zu nennen, die sich in den letzten Jahren am Standort etabliert haben:
- Landingpage und Newsletter zur digitalen Barrierefreiheit
- Digitale Barrierefreiheit als Querschnittsthema der Digitalstrategie der UHH (Universität Hamburg 2023)
- Befugte Stelle für den Zugang zu barrierefreier Literatur
- Unbefristete Stellen für digitale Barrierefreiheit in Studium und Lehre sowie Verwaltung und Webseitengestaltung
- Lehrer:innenbildung: Servicestelle Inklusive Schule ohne Barrieren (InkluSoB)
Rechtliche Rahmenbedingungen
Bei dem Thema rechtliche Rahmenbedingungen kann die UN-Behindertenrechtskonvention als Grundlage eingeordnet werden. Hier wurde in Artikel 9 das Konzept der Zugänglichkeit verankert (BGBl 2008, S. 1428). Für öffentliche Stellen gilt auf Bundesebene das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGBl 2002, Abschnitt 2a) und die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BGBl 2011). Eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit besteht für Webseiten, eingestellte Dokumente und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen. Außerdem müssen die öffentlichen Stellen im Rahmen der Barrierefreiheitserklärung einen Feedbackmechanismus anbieten, über den Barrieren gemeldet werden können. Je nach Bundesland haben die öffentlichen Stellen, innerhalb einer Frist von zwei bis sechs Wochen, Zeit für eine befriedigende Rückmeldung. Sollte die Barriere nicht abgebaut werden, kann sich die Person oder auch ein Verband an die jeweilige Schlichtungsstelle (bzw. je nach Bundesland Durchsetzungsstelle oder Ombudsstelle) wenden (Barrierefreie IT-Hessen 2022).
Im Vortrag wurde der Fokus auf das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gelegt, das im Juni 2025 in Kraft tritt (BGBl 2022). In diesem Kontext bestehen zum jetzigen Zeitpunkt noch viele offene Fragen. Laut aktueller Planung sollen bundesweit circa 30 Stellen (Vollzeitäquivalente) verteilt auf die Bundesländer geschaffen werden. Dabei ist eine Andockung an die Schlichtungsstellen in Verbindung mit Marktüberwachungsstellen geplant. Es wird eine höhere Anzahl an Meldungen erwartet als aktuell bei den öffentlichen Stellen, konkrete Einschätzungen sind allerdings kaum möglich. Im Gegensatz zur Regelung bei den öffentlichen Stellen gibt es die mögliche Konsequenz, dass das Produkt vom (deutschen) Markt genommen werden muss. Es gibt auch einige Problemfelder in Bezug auf das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Einschränkungen sind die Begrenzung auf neu in den Verkehr gebrachte Produkte sowie teilweise lange Übergangsfristen (Selbstbedienungsterminals 2040). Außerdem besteht ein Spannungsfeld bei der Überwachung zwischen lokalen Anbietenden und global aktiven Firmen.
Barrierefreie Dokumente
Es wurden sechs Grundbereiche aufgelistet, die alle Personen bei der Dokumenterstellung berücksichtigen sollten. Außerdem sollte eine Barrierefreiheitsprüfung zur groben Einschätzung und zur Verbesserung der Zugänglichkeit durchgeführt werden.
-
Dokumenteigenschaften:
- Titel
- Sprache
-
Textverarbeitung:
- Formatvorlagen
- Links
- Tabellen
- Bilder und Grafiken
Erfahrungen aus der Praxis bei Workshops im universitären Kontext zeigen, dass die ersten vier Bereiche (Titel festlegen, Sprache einstellen, Formatvorlagen für Überschriften, Listen etc. nutzen, Links aussagekräftig beschriften) häufig unproblematisch umgesetzt werden können. Die letzten beiden Bereiche (Gestaltung von barrierefreien Tabellen und das Verfassen von Alternativtexten) werden häufig als schwierig bewertet.
Als weiteres Thema wurden Besonderheiten bei PowerPoint-Präsentationen kurz skizziert. Aufgrund des Entstehungsprozesses bei Präsentationen stimmen visuelle Abfolge der Text- und Bildfenster häufig nicht mit der Lesereihenfolge überein. Daher empfiehlt sich nach Abschluss der Bearbeitung eine Prüfung bzw. ggf. Korrektur der Lesereihenfolge. Außerdem ist die Gruppierung grafischer Elemente wichtig, sonst wird jedes Element einzeln vorgelesen. Daher müssen die einzelnen Teile als ein zusammengehöriges Element gruppiert und ein Alternativtext muss hinzugefügt werden. Es folgen grundsätzliche Hinweise für eine gute barrierefreie Foliengestaltung:
- Einheitliche Layouts (wenn möglich barrierefreie Vorlage verwenden, jeweils passendes Layout auswählen (Titelfolie, verschiedene Inhaltsfolien))
- Klare und verständliche Sprache
- Ausreichende Schriftgröße und gut lesbare Schriftart
- Hervorhebungen nicht nur über Farbe
- Animationen sparsam einsetzen und Notwendigkeit prüfen
Zum Abschluss des Themas barrierefreie Dokumente wurde der Export als PDF-Dokument kritisch beleuchtet. Dieses Dateiformat wurde von Sehenden für Sehende entwickelt, um ein barrierefreies Dokument zu erstellen sind aufwendige Nacharbeiten notwendig. Schon vorhandene Strukturinformationen beispielsweise aus LaTeX gehen beim Export verloren. Dies steht im Widerspruch zum Konzept der Barrierefreiheit von Anfang an. Als Alternativformat wird EPUB3 vorgeschlagen, da eine gute Trennung von Inhalt und Gestaltung möglich ist und gute Navigationsmöglichkeiten (Inhaltsverzeichnis, Orientierungspunkte) bestehen. Es existieren eingebaute Funktionen für Barrierefreiheit von Anfang an und ein Export in unterschiedliche Formate ist je nach Bedarf sinnvoll und einfach möglich (z. B. HTML, Word) (Kern et al. 2022).
Fazit
Gesetzliche Verpflichtungen zur Umsetzung von barrierefreien Produkten und Dienstleistungen nehmen zu (z. B. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz). Ziel sollte es sein, von vornherein Dokumente „Born Accessible“ zu gestalten. Hierbei spielt das Konzept des Universal Design eine entscheidende Rolle (Lanners 2020). Barrierefreiheit muss von Anfang an als Querschnittsthema mitgedacht werden, um Fehlentscheidungen zu verhindern.
Literaturverzeichnis
Barrierefreie IT-Hessen (Hg.) (2022). Vorstellung der Durchsetzungsstellen der Länder und der Schlichtungsstelle des Bundes. Online verfügbar unter https://lbit.hessen.de/durchsetzungs-und-ueberwachungsstelle/durchsetzungsstellen-der-laender (abgerufen am 26.10.2023).
BGBl (2002). Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz). BGG, vom 23.05.2022. Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.html (abgerufen am 20.10.2023).
BGBl (2008). Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. UN-BRK. Online verfügbar unter https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf (abgerufen am 10.10.2023).
BGBl (2011). Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung). BITV 2.0, vom 21.05.2019. Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html (abgerufen am 01.10.2023).
BGBl (2022). Verordnung über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
Kern, Fabian/Minnemann, Dana/Moldovan, Diana/Muchenberger, Manfred/Schengber, Julia/Schwab, Carsten/Tschersich, Alexander (2022). Leitfaden EPUB3-E-Books. Eine Handreichung der Arbeitsgruppe EPUB in der Taskforce Barrierefreiheit des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. Online verfügbar unter https://www.boersenverein.de/beratung-service/barrierefreiheit/leitfaden-barrierefreie-epub3-e-books/ (abgerufen am 26.10.2023).
Kroher, Martina/Beuße, Mareike/Isleib, Sören/Becker, Karsten/Ehrhardt, Marie-Christin/Gerdes, Frederike et al. (2023). Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021. Hg. v. BMBF. Online verfügbar unter https://www.die-studierendenbefragung.de/fileadmin/user_upload/Downloads/22_Sozialerhebung.pdf (abgerufen am 02.08.2023).
Kultusministerkonferenz (Hg.) (1982). Verbesserung der Ausbildung für Behinderte im Hochschulbereich. Online verfügbar unter http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1982/1982_06_25-Behinderte-Hochschulbereich.pdf (abgerufen am 02.08.2023).
Lanners, Romain (2020). Neue Lehrmittel im Universal Design. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 26 (10), S. 17–26.
Peschke, Susanne/Gattermann-Kasper, Maike (2022). Barrierefreie Prüfungen. Möglichkeiten, Herausforderungen und Praxisbeispiele bei digitalen Prüfungsformaten. blind-sehbehindert 142 (4), S. 292–299.
Schütt, Marie-Luise/Gattermann-Kasper, Maike (2021). Auf dem Weg zu einer Hochschule für Alle – Praxistipps für die Gestaltung inklusiver(er) Lehre. Hochschuldidaktik. In: Nicola Hericks (Hg.). Inklusion, Diversität und Heterogenität. Begriffsverwendung und Praxisbeispiele aus multidisziplinärer Perspektive. Wiesbaden, Heidelberg: Springer VS (Research), S. 287–308.
Universität Hamburg (Hg.) (2023). Digitalstrategie. UHH. Digital 2028. Online verfügbar unter https://www.fid.uni-hamburg.de/digitalstrategie.pdf (abgerufen am 02.08.2023).