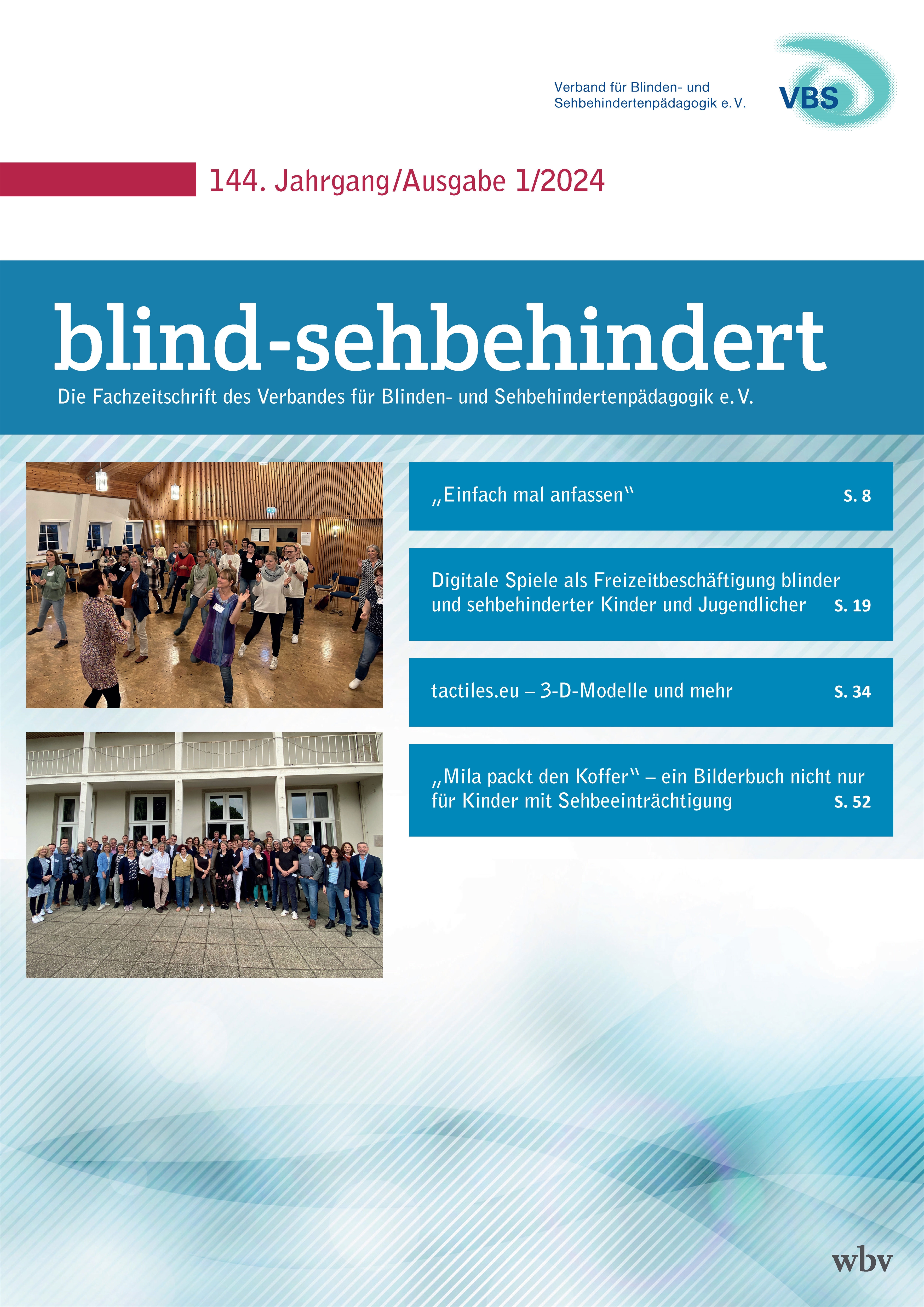Digitale Spiele als Freizeitbeschäftigung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher
1 Einleitung
In der Arbeit werden unter digitalen Spielen alle Spieloptionen, Computer-, Konsolen-, Tablet- und Smartphonespiele, aber auch Spiele-Apps und Onlinespiele zusammengefasst. Digitale Spiele sorgen für Unterhaltung, Entspannung und Abwechslung im Alltag. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen lösen sie eine große Begeisterung aus. Fast zwei Drittel der Heranwachsenden im Alter von 12 bis 19 Jahren konsumieren regelmäßig digitale Spiele (vgl. MPFS 2020, S. 53). Sie bilden einen wichtigen Teil der Jugendkultur und zählen zur täglichen Freizeitgestaltung vieler Kinder und Jugendlicher (vgl. Preisinger 2022, S. 23). Studien zeigen, dass Heranwachsende mit und ohne Beeinträchtigungen identische Freizeitinteressen und -bedürfnisse haben und ähnliche Freizeitaktivitäten verfolgen (z. B. vgl. Markowetz 2009, S. 34). Aufgrund der visuellen Darbietungsform stellen digitale Spiele für Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung und Blindheit jedoch eine Herausforderung dar. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob digitale Spiele in ihre Freizeit integriert sind und wie intensiv diese genutzt werden (können). Es liegen nur wenige Studien vor, die das digitale Spielen als Freizeitbeschäftigung blinder und sehbehinderter Heranwachsender analysierten. Erste Untersuchungen zu einzelnen Bereichen des Spielverhaltens blinder und sehbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher nahmen Liebal (2012), Wrzesińska et al. (2021) und Buaud et al. (2002) vor. So zeigen Wrzesińska et al., dass die von der Zielgruppe am häufigsten benutzten Spielgeräte der PC/Laptop (70 %) und das Smartphone/Handy (60 %) sind. Die Konsole wird am wenigsten für das digitale Spielen genannt (30 %) (vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 5). Während die Spieldauer von Montag bis Freitag bei durchschnittlich 88 bis 120 Minuten pro Tag liegt, ist sie am Wochenende wesentlich höher: Pro Tag beträgt sie 148 bis 210 Minuten (vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 4). Liebal befragte die 7- bis 18-Jährigen zu ihren Spielmotiven. Zeitvertreib, Spaß und Langeweile sind die am häufigsten genannten Gründe für das digitale Spielen (vgl. Liebal 2012, S. 129). Erhebungen zu den bevorzugten Sozialformen beim digitalen Spielen blinder und sehbehinderter Jugendlicher gibt es bislang noch keine. Die Untersuchungen von Andrade et al., welche das Spielverhalten erwachsener Spielerinnen und Spieler mit Blindheit und Sehbehinderung analysierten, weisen jedoch darauf hin, dass überwiegend allein gespielt wird (vgl. Andrade et al. 2019, S. 5 f.). Hinsichtlich der Spielpräferenzen lässt sich sagen, dass sehbehinderte Jugendliche fast alle Spielgenres häufiger als blinde Jugendliche spielen (vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 5). Während sehbehinderte Kinder und Jugendliche als bevorzugte Spiele beispielsweise Rennspiele wie „Mario Kart“ oder Simulationsspiele wie „Die Sims“ nannten, gaben die Probandinnen und Probanden mit Blindheit ausschließlich audio- und textbasierte Spiele an (vgl. Liebal 2012, S. 129). Zudem befragte Liebal die Zielgruppe zu möglichen Barrieren und Problemen beim digitalen Spielen. Festgestellt werden konnte, dass sehbehinderte Kinder und Jugendliche ihre Sehbehinderung grundsätzlich nicht als nachteilig empfinden und erst beim konkreten Nachfragen sehspezifische Herausforderungen beim digitalen Spielen angaben, wie z. B. eine zu kleine oder kontrastarme Schrift, Untertitel, welche nicht vergrößert oder pausiert werden können, zu kleine Grafiken und Bilder oder nicht wahrnehmbare 3-D-Darstellungen. Aus ihren Darstellungen lässt sich schlussfolgern, dass sehbehinderte Kinder und Jugendliche grundsätzlich auf wenig Probleme beim digitalen Spielen stoßen. Mithilfe von einzelnen Zusatzfunktionen, welche ihnen das Spielen erleichtern, können sie dieselben Spiele wie nicht sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche spielen. Blinde Spielerinnen und Spieler hingegen können nur spezielle für sie zugängliche Spiele nutzen, da die gängigen digitalen Spiele für sie nicht umsetzbar sind (vgl. Liebal 2012, S. 129 f.). Buaud et al. kamen in ihren Untersuchungen zu identischen Feststellungen (vgl. Buaud et al. 2002, S. 176). Ableitend aus den aufgeführten Problematiken wünschen sich die Teilnehmenden aus Liebals Studie für zukünftige Spiele die Option „Sprachausgabe“, damit Texte vorgelesen werden können, eine einfache Bedienung der Spiele, kurze und gut verständliche Anleitungen in geschriebener und gesprochener Form, Funktionen zur Vergrößerung, Helligkeitsanpassung, Kontrasteinstellung und Farbauswahl sowie eine Sprachsteuerung, welche blinde Spielerinnen und Spieler konkreter anleitet (vgl. Liebal 2012, S. 130).
Eine ausführliche und aktuelle Darstellung des Spielverhaltens blinder und sehbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher, welche unterschiedliche Aspekte beleuchtet, liegt im deutschsprachigen Raum bislang nicht vor. Bis dato durchgeführte Studien betrachteten nur Teilaspekte und bilden nicht den aktuellen Stand des Spielverhaltens ab. Demzufolge wurde mit der vorliegenden Studie das Ziel verfolgt, das Spielverhalten sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher detailliert zu eruieren, um die Rolle der digitalen Spiele in ihrem Leben und in ihrer Freizeit ausführlicher zu analysieren. Die zu untersuchende Fragestellung lautet:
Welches Nutzungsverhalten zeigen Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbehinderung im Hinblick auf digitale Spiele?
Um die im Zentrum stehende Fragestellung zu beantworten, wurden fünf differenzierte Unterbereiche mit entsprechenden Fragestellungen gebildet:
- Welche Gewohnheiten und Präferenzen zeigen Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbehinderung beim digitalen Spielen?
- Welche Barrieren und Probleme treten für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche beim digitalen Spielen auf?
- Sind digitale Spiele in die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung integriert?
- Können blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche an dem digitalen Kulturgut „Digitale Spiele“ teilhaben?
- Unter welchen Bedingungen können Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbehinderung digitale Spiele nutzen?
2 Methodisches Vorgehen
Forschungsdesign und Erhebungsmethode
Um das Nutzungsverhalten anhand der oben aufgeführten Fragen zu erforschen, wurde ein quantitatives Forschungsdesign gewählt. Dazu haben die Probandinnen und Probanden an einer Onlineumfrage teilgenommen. Es wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet, der aus Teilen eines bereits vorhandenen und validierten Fragebogens (Andrade et al. 2019, S. 4 ff.) besteht und um selbst konstruierte Items erweitert wurde. Die Items des Fragebogens nach Andrade et al. wurden übersetzt, sprachlich angepasst und inhaltlich ergänzt (MPFS 2020, S. 53 ff.; Pohlmann 2007, S. 9 f.; LMZ; Gameyard!). Mithilfe der Leitfäden zur Erstellung von Fragebögen nach Porst (2014) und Aeppli et al. (2016) wurden fehlende Items selbst konstruiert. Als inhaltliche Basis dienten insbesondere die Studien von Liebal (2012) und Wrzesińska et al. (2021).
Der Fragebogen beinhaltet 23 offene, halboffene und geschlossene (Single-Choice- und Multiple-Choice-Fragen) Fragen und umfasst insgesamt 25 Seiten. Der Hauptteil des Fragebogens setzt sich aus den drei Teilbereichen „Spielgewohnheiten“, „Spielpräferenzen“ und „Barrieren und Grenzen“ zusammen, die jeweils unterschiedlich viele Items beinhalten (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Teilbereiche und Items
|
Teilbereich |
Items |
|---|---|
|
Spielgewohnheiten |
|
|
Spielpräferenzen |
|
|
Barrieren und Grenzen |
|
Stichprobe
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Stichprobe der Studie. Das Geschlechterverhältnis war mit 15 weiblichen (51,7 %) und 14 männlichen (48,3 %) Personen sehr ausgeglichen. Das Durchschnittsalter lag bei 14,6 Jahren. Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 10, die ältesten 18 Jahre alt. Am häufigsten nahmen 15- und 18-Jährige an der Studie teil. Der überwiegende Teil der Befragten von der Stichprobe besuchte zum Zeitpunkt der Erhebung das Gymnasium und die meisten gingen in die 10. Klasse. 16 Kinder und Jugendliche gaben an, blind zu sein (55,2 %), 7 bezeichneten sich als hochgradig sehbehindert (24,1 %) und 6 als sehbehindert (20,7 %). Es nahm keine Person mit einer geringen Sehbeeinträchtigung an der Studie teil.
Tabelle 2: Soziodemografische Zusammensetzung der Stichprobe
Geschlecht
Alter
Schulart
Grad der Sehbehinderung
|
Anmerkung: M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; D = Modalwert; N = Gesamtzahl
Durchführung
Für die Datenerhebung wurde die Internetplattform SoSci Survey (Programm-Version 3.3.13) genutzt, da diese über einen barrierefreien Modus verfügt. Der Fragebogen wurde zur Überprüfung auf Barrierefreiheit und Identifizierung potenzieller missverständlicher Fragen zunächst in einem Pretest an Dozierende und Studierende des Fachbereichs sowie an eine Person mit Blindheit und eine Person mit Sehbehinderung übermittelt. Nachdem der Fragebogen modifiziert wurde, konnte mit der Datenerhebung begonnen werden. Sie erstreckte sich über einen Zeitraum von 29 Tagen. Der Fragebogen wurde deutschlandweit sowohl per E-Mail ausgesendet als auch über die sozialen Medien gestreut. Da die Zielgruppe der vorliegenden Studie als Kinder und Jugendliche im Alter von 10;0 bis 18;11 Jahren mit einer Sehbeeinträchtigung (Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Sehbehinderung oder geringe Sehbeeinträchtigung) definiert ist, wurden für das Rekrutieren von Probandinnen und Probanden gezielt Blinden-/Sehbehindertenverbände und -gruppen kontaktiert. Von insgesamt 39 teilgenommenen Personen mussten 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. 3 Probandinnen und Probanden äußerten sich weder zu ihrem Alter noch zu ihrer Sehbeeinträchtigung und konnten somit nicht der beschriebenen Zielgruppe zugeordnet werden. Die restlichen 7 Personen brachen die Bearbeitung des Bogens während der soziodemografischen Erfragung ab und lieferten keine verwertbaren Ergebnisse für die Untersuchung. Somit bezifferte die Studie im Gesamten einen Umfang von 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
3 Darstellung der Ergebnisse
Das folgende Kapitel stellt eine überblicksartige Zusammenfassung der relevantesten Ergebnisse dar. Da nicht alle Probandinnen und Probanden jede Frage beantworteten, war es notwendig, die Anzahl der Probandinnen und Probanden für jede Variable getrennt auszuwerten.
Spielgewohnheiten
In Bezug auf die Spielgewohnheiten der blinden und sehbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen (siehe Tabelle 3) ergab die Onlineumfrage, dass das Smartphone das meistgenutzte Gerät für das digitale Spielen ist. Die feste Spielkonsole wurde von keinen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern angegeben. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass fast die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen täglich digital spielt (blinde Probandinnen und Probanden: 11/68,8 %; hochgradig sehbehinderte Probandinnen und Probanden: 1/14,3 %; sehbehinderte Probandinnen und Probanden: 2/33,3 %), und die Nutzungsdauer beträgt sowohl unter der Woche als auch am Wochenende bei den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine halbe Stunde bis 2 Stunden am Tag. Im Vergleich zu der Nutzungsdauer unter der Woche, bei der nur 1 Person angab, mehr als 2 Stunden am Tag zu spielen, wählten für das Wochenende 7 Probandinnen und Probanden (28,0 %) diese Antwortoption. Die blinden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben bei der Nutzungsdauer am Wochenende die Antwortmöglichkeit „2 bis 4 Stunden“ (4 Probandinnen und Probanden, 28,6 %) deutlich häufiger an als die hochgradig sehbehinderten und sehbehinderten Probandinnen und Probanden (1 Probandin bzw. Proband, 16,7 % und 20,0 %). Aus den Ergebnissen lässt sich außerdem entnehmen, dass 81,5 % der befragten Kinder und Jugendlichen zu digitalen Spielen greifen, weil diese ihnen Spaß machen. Festgestellt werden konnte auch, dass im Vergleich zu den hochgradig sehbehinderten und sehbehinderten Heranwachsenden mehr Kinder und Jugendliche mit Blindheit digitale Spiele nutzen, um mit anderen Spielerinnen und Spielern Zeit zu verbringen (blinde Probandinnen und Probanden: 8/53,3 %; hochgradig sehbehinderte und sehbehinderte Probandinnen und Probanden: 1/16,7 %). Die präferierte Sozialform für das digitale Spielen ist bei der Mehrzahl der Probandinnen und Probanden das Alleinspielen. Jedoch konnten auch hier Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Während keiner der blinden Probandinnen und Probanden das Spielen mit Freundinnen und Freunden (in einem Raum) als häufigste Sozialform nannte, wählten die sehbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben dem Alleinspielen das Spielen mit Freundinnen und Freunden am häufigsten. Die blinden Spielerinnen und Spieler bevorzugen das Alleinspielen und das Onlinespielen mit Freundinnen und Freunden. Neben den präferierten Spielarten, bei denen audiobasierte Spiele bevorzugt werden, äußerten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu ihren präferierten Spielgenres (N = 25). Beliebt sind insbesondere die Genres „Lernspiele/Denkspiele/Gedächtnisspiele“, „Audiospiele“ und „Rollenspiele/MUDs (textbasiert)/Strategiespiele“. Die Genres „Kriegsspiele“, „Horrorspiele“, „Schießspiele/Ego-Shooter“ und „Sportspiele“ wurden am wenigsten angegeben. Zu den bevorzugten Genres der blinden und hochgradig sehbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählen Audio-, Rollen-, Lern- und Geschicklichkeitsspiele. Im Vergleich dazu nannten die sehbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältige grafikbasierte Genres, wie „Simulationsspiele“, „Geschicklichkeitsspiele“ oder „Abenteuerspiele/Jump ’n’ Runs“.
Tabelle 3: Ergebnisse des Teilbereichs Spielgewohnheiten
|
Items |
N |
Antwortmöglichkeiten |
|---|---|---|
|
29 |
Smartphone (19/65,5 %); |
|
29 |
Nie (2/6,9 %); Täglich (14/48,3 %); Mehrmals in der Woche (8/27,6 %); Einmal in der Woche bis einmal alle 14 Tage (1/3,4 %); Einmal im Monat (4/13,8 %) |
|
29 |
Nie (2/6,9 %); Bis zu einer halben Stunde (6/20,7 %); Halbe Stunde bis 2 Stunden (20/69,0 %); 2 bis 4 Stunden (1/3,4 %); 4 Stunden und mehr (0) |
|
25 |
Nie (3/12,0 %); Bis zu einer halben Stunde (4/16,0 %); Halbe Stunde bis 2 Stunden (11/44,0 %); 2 bis 4 Stunden (6/24,0 %); 4 Stunden und mehr (1/4,0 %) |
|
27 |
Spaß (22/81,5 %); Langeweile/Zeitvertreib (14/51,9 %); Um mit anderen Zeit zu verbringen (10/37,0 %); Das Spielen fordert mich heraus (7/25,9 %); Das Spielen entspannt/beruhigt mich (13/48,1 %) |
|
25 |
Allein (12/48,0 %); Mit Familie (2/8,0 %); Mit Freunden (2/8,0 %); Mit Fremden online (3/12,0 %); Mit Freunden online (6/24,0 %) |
|
25 |
Audiobasierte Spiele (14/56,0 %); Textbasierte Spiele (8/32,0 %), Grafikbasierte Spiele (3/12,0 %) |
Anmerkung 1: N = Gesamtzahl der Probandinnen und Probanden
Anmerkung 2: Ergebnisse zu den 3 Gruppen „Blindheit“, „hochgradige Sehbehinderung“ und „Sehbehinderung“ sind nicht aus der Tabelle zu entnehmen
Spielpräferenzen
In Frage 9 äußerten sich die Probandinnen und Probanden zu ihren individuellen Spielbevorzugungen („Welche digitalen Spiele spielst du am liebsten?“). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Blindheit gaben insbesondere unterschiedliche Spiele aus dem Genre „Audiospiele“ an wie beispielsweise „Manamon“, „Ritter Manager“ oder „A Blind Legend“ und aus dem Genre „Rollenspiele“ wurden etwa „Clash Royale“ oder „Lords & Knights“ genannt. Zu den präferierten Spielen der hochgradig sehbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen hauptsächlich Spiele wie „Quiz Land“ oder „Wer wird Millionär“ des Genres „Lernspiele“ und auch Spiele wie „Lifeline“ und „Das schwarze Schwert“ aus der Kategorie „Rollenspiele“. Die Probandinnen und Probanden mit Sehbehinderung nannten verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Genres wie „Super Mario“, „Just Dance“, „Candy Crush“ oder „Minecraft“.
Auf die Frage, weshalb sie die genannten Spiele bevorzugen, nannte die Hälfte der Kinder und Jugendlichen den Aspekt „Zugänglichkeit der Spiele/Möglichkeit, die Spiele zu spielen“ sowie damit verbundene Begründungen (Spielzugänglichkeit mittels Sprachausgabe, eigenständige Bedienung, einfache Umsetzbarkeit usw.). Als weiteren Grund gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „Spaß/Zeitvertreib“ (50,0 %) an und von weiteren 50 % der Probandinnen und Probanden wurden „spielspezifische Eigenschaften/Spielinhalte“ (die einzigartige Spielhandlung, die besondere Welt der Spiele, herausfordernde Rätsel usw.) aufgeführt. Auch die „soziale Interaktion“ (Kontakt zu anderen Spielerinnen und Spielern) wurde von 1 Teilnehmerin aufgeführt.
10 von 18 Probandinnen und Probanden (7 mit Blindheit, 3 mit hochgradiger Sehbehinderung) gaben an, dass sie zusätzliche Softwares oder Hilfsmittel benutzen, um die oben aufgeführten Spiele nutzen zu können. Die Mehrheit bezog sich hierbei auf Screenreader oder Sprachausgaben. Die übrigen 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwenden spielintegrierte Hilfsmittel, greifen auf audio-/textbasierte Spiele zurück oder benötigen grundsätzlich keine Hilfsmittel für das digitale Spielen.
Mit Schwierigkeiten und Herausforderungen sind viele der Probandinnen und Probanden beim Spielen der aufgeführten Lieblingsspiele konfrontiert. 13 von 17 Teilnehmenden (76,5 %) beantworteten die Frage „Gibt es Herausforderungen oder Schwierigkeiten bei diesen Spielen?“ mit „Ja“. Hiervon nannten 8 Kinder und Jugendliche (47,1 %) spezifische und durch die Sehbeeinträchtigung bedingte Probleme (unleserliche Schrift des Spiels, keine Kompatibilität der Sprachausgabe mit den Spielen, keine Beschreibung grafischer Elemente usw.).
In der letzten Frage des Teilbereichs „Spielpräferenzen“ gaben die Teilnehmenden an, was ihrer Meinung nach ein gutes Spiel ausmache. Den Kindern und Jugendlichen mit Sehbehinderung und Blindheit sind insbesondere die „Benutzerfreundlichkeit“ (Bedienung einfach und logisch, gute Darstellung von Schrift und Bild usw.) sowie „barrierefreie Aspekte“ (auditive Elemente, Hilfsmittelnutzung möglich, Einstellungsmöglichkeiten wie Vergrößerung und Kontrast usw.) eines Spiels wichtig. Kriterien wie „Gute Qualität von Bild und Ton“ und „Besondere Charaktere im Spiel“ wurden von deutlich weniger Probandinnen und Probanden genannt.
Barrieren und Grenzen
12 Probandinnen und Probanden (10 mit Blindheit, 2 mit hochgradiger Sehbehinderung) führten in Frage 14 Spiele auf, welche sie gerne spielen würden, aufgrund von nicht gegebener Barrierefreiheit jedoch nicht können. Von den Kindern und Jugendlichen wurden digitale Spiele wie „Minecraft“ (4 Probandinnen und Probanden, 33 %), „Die Sims“ (3 Probandinnen und Probanden, 25 %), „Fortnite“ (2 Probandinnen und Probanden, 16,7 %) aufgeführt. Auch die Kategorie „Konsolenspiele“ nannten 3 Teilnehmende (25 %). Weitere Spiele wie z. B. „Animal Crossing“, „Among Us“ oder „Skyrim“ wurden von jeweils 1 Person genannt.
In der darauffolgenden Frage äußerten sich dieselben Probandinnen und Probanden zu den Barrieren und Problemen, welche das Spielen der in Frage 14 aufgeführten Spiele verhindern. Genannt wurden Barrieren wie „Fehlende Kompatibilität der Screenreader/Sprachausgaben mit den Spielen“, „Fehlende auditive Elemente/fehlende Orientierung bzw. Orientierungspunkte“, aber auch Probleme wie die zu kleine Größe relevanter visueller Elemente der Spiele und die erschwerte Steuerung dieser sowie auch die problematische Navigation in den Spielmenüs aufgrund der nicht gegebenen Steuerung mittels Pfeiltasten. Ebenfalls aufgeführt wurden allgemeinere sehbehinderten- und blindenspezifische Problematiken wie die zumeist optische Ausrichtung oder bildbasierte Spiele, die das Spielen mittels Hilfssoftwares, wie Screenreader, nicht umsetzbar machen.
Abgeschlossen wurde der Teilbereich „Barrieren und Grenzen“ mit der Aufführung von digitalen Spielen, welche für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung geeignet sind. Die Probandinnen und Probanden (8 mit Blindheit, 3 mit hochgradiger Sehbehinderung und 1 mit Sehbehinderung) nannten sowohl audiobasierte Spiele/Audiospiele („Sound of Magic“, „Manamon“, „Der Tag wird zur Nacht“, „Blind Drive“ usw.), textbasierte Spiele („Lifeline“, „Onebutton Travel“ usw.) als auch barrierefreie grafikbasierte Spiele („Crafting Kingdom“, „Galactic Colonies“ usw.).
4 Diskussion und Schlussfolgerungen
In der hier vorgestellten Studie wurde das digitale Spielen als Freizeitbeschäftigung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher untersucht. Unter Berücksichtigung der in der Einleitung abgebildeten Forschungsfragen und bereits bestehender Forschungsergebnisse werden im Folgenden die wichtigsten Resultate analysiert und diskutiert sowie mit den Ergebnissen nicht sehbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher verglichen.
Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass ein erheblicher Teil der Kinder und Jugendlichen mit Blindheit und Sehbehinderung digitale Spiele nutzt. Das Smartphone ist wie bei den Kindern und Jugendlichen ohne Sehbeeinträchtigungen ebenfalls das meistgenutzte Gerät für digitale Spiele (vgl. MPFS 2020, S. 55). Sowohl in der Studie von Wrzesińska et al. (vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 5) als auch in der vorliegenden Untersuchung sind Konsolen die am wenigsten genutzten Spielgeräte von Kindern und Jugendlichen mit Blindheit und Sehbehinderung. Möglicherweise liegt dies an der nicht gegebenen Barrierefreiheit der Konsolenspiele (Frage 14). Über 70 % der vorliegenden Studiengruppe spielt täglich oder mehrmals die Woche und dies für meistens 30 bis 120 Minuten am Tag. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie decken sich mit bestehenden Forschungsergebnissen (vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 4) insofern, als Heranwachsende mit Blindheit und Sehbehinderung am Wochenende ihre freie Zeit mehr mit dem digitalen Spielen verbringen als unter der Woche. Außerdem konnte festgestellt werden, dass blinde Kinder und Jugendliche häufiger zu digitalen Spielen greifen als sehbehinderte und hochgradig sehbehinderte Heranwachsende und auch eine höhere Spieldauer am Wochenende aufweisen. Möglicherweise hängt dies u. a. mit der Neigung blinder Heranwachsender zu passiven Freizeitaktivitäten, aufgrund des erschwerten Ausübens aktiver Tätigkeiten wie etwa sportliche Betätigung oder Unternehmungen außerhalb des Hauses, zusammen (vgl. Lindmeier & Bickes 2015, S. 282 ff.).
Der überwiegende Teil der Probandinnen und Probanden spielt digitale Spiele aus Gründen wie Spaß, Zeitvertreib und Langeweile. Identische Resultate weist auch die Studie von Liebal auf (vgl. Liebal 2012, S. 129). Zudem zeigen die Ergebnisse, dass sich insbesondere Kinder und Jugendliche mit hochgradiger Sehbehinderung und Blindheit im Vergleich zu Gleichaltrigen mit nicht beeinträchtigtem Sehvermögen (vgl. Bitkom 2020, S. 36) seltener mit anderen Personen zum digitalen Spielen (in einem Raum) treffen. Sie präferieren das Alleinspielen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte zum einen sein, dass für das gemeinsame Spielen insbesondere feste Spielkonsolen sowie entsprechende Spiele genutzt werden (vgl. Bitkom 2020, S. 36), welche jedoch für blinde und stark sehbeeinträchtigte Spielerinnen und Spieler oftmals nicht barrierefrei sind und das gemeinsame Spielen somit verhindern. Zum anderen ist zu beachten, dass insbesondere blinde Jugendliche ihre Freizeit überwiegend allein verbringen und einen kleineren sozialen Radius haben können (vgl. Lindmeier & Bickes 2015, S. 282 f.). Hinsichtlich der Spielpräferenzen konnten eindeutige Unterschiede zwischen den sehbehinderten und hochgradig sehbehinderten bzw. blinden Probandinnen und Probanden festgestellt werden. Während die blinden und hochgradig sehbehinderten Heranwachsenden, aufgrund der vorhandenen Barrierefreiheit, überwiegend audio- und textbasierte Spiele spielen, nutzen die sehbehinderten Kinder und Jugendlichen vielfältige grafikbasierte Spiele. Sehbehinderte Nutzerinnen und Nutzer haben eine größere Spieleauswahl, da sie beim Spielen auf weniger Schwierigkeiten stoßen. Identische Schlussfolgerungen ziehen auch Liebal, Wrzesińska et al. und Buaud et al. in ihren Untersuchungen (vgl. Liebal 2012, S. 129 f.; vgl. Wrzesińska et al. 2021, S. 7; Buaud et al. 2002, S. 176). Zudem zeigt die vorliegende Studie eindeutige Differenzen zwischen den Lieblingsspielen nicht sehbeeinträchtigter und sehbeeinträchtigter, insbesondere blinder und hochgradig sehbehinderter, Heranwachsender. Viele der präferierten Spiele der Jugendlichen mit nicht beeinträchtigtem Sehvermögen, wie z. B. „Minecraft“, „Fortnite“, „Die Sims“ oder „Animal Crossing“ (vgl. MPFS 2020, S. 57), gaben die blinden und hochgradig sehbehinderten Probandinnen und Probanden bei den Spielen an, welche sie gerne nutzen würden, aber aus barrierebedingten Gründen nicht nutzen können (Frage 14).
Die häufige Nutzung und intensive Spieldauer zeigen auf, dass digitale Spiele eine hohe Bedeutung im Alltag der befragten Kinder und Jugendlichen mit Blindheit und Sehbehinderung haben und Teil ihrer Freizeitgestaltung sind. Nur 2 der 29 Probandinnen und Probanden gaben an, dass sie sich nie mit digitalen Spielen beschäftigen. Wie bei den Heranwachsenden ohne Sehbeeinträchtigungen scheinen digitale Spiele auch für die Mehrzahl der Studiengruppe dieser Arbeit von hoher Bedeutung zu sein. Allerdings ist die Partizipation an dieser Form der Freizeitgestaltung für sie oftmals aufgrund von Barrieren erschwert oder gänzlich verhindert. Insbesondere blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche stoßen auf spielverhindernde Barrieren, wie fehlende auditive bzw. taktile Orientierungspunkte im Spiel oder eine nicht gegebene Hilfsmittelkompatibilität (Frage 15), und der Zugang zu populären Spielen bleibt ihnen weiterhin verwehrt. Auch Barrieren, welche das selbstständige digitale Spielen von Lieblingsspielen erschweren, wurden von blinden und hochgradig sehbehinderten Teilnehmenden aufgeführt. Die sehbehinderten Spielerinnen und Spieler hingegen erleben zwar manchmal spielerschwerende Barrieren, wie beispielsweise unleserliche Texte, jedoch lässt sich aus den Resultaten ableiten, dass sie alle digitalen Spiele spielen können. Sie nannten keine spielverhindernden Barrieren sowie Spiele, welche sie barrierebedingt nicht nutzen können. Grundsätzlich scheint es für sie möglich zu sein, dieselben Spiele wie Gleichaltrige mit unbeeinträchtigtem Sehvermögen zu nutzen, was sich mit den Erkenntnissen aus bereits bestehenden Forschungen deckt (vgl. Liebal 2012, S. 2012, S. 129 f.; Buaud et al. 2002, S. 176). Aus diesen Befunden kann geschlussfolgert werden, dass die Teilhabe an der Freizeitbeschäftigung „digitale Spiele“ für Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung zwar gelegentlich erschwert, aber grundsätzlich möglich ist. Blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche sind deutlich stärker benachteiligt. Die Teilhabe am digitalen Spielen ist für sie nur begrenzt möglich. Daher sind Anpassungen wie Orientierungspunkte in Form von auditiven oder taktilen Elementen, welche grafische Informationen des Spiels ausgleichen, oder die Kompatibilität der Spiele mit Hilfsmittelsoftware für blinde und hochgradig sehbehinderte Nutzerinnen und Nutzer vonnöten. Auch angemessene Vergrößerungsmöglichkeiten sowie Farb-, Kontrast und Helligkeitsanpassungen für sehbehinderte Spielerinnen und Spieler sollten ebenfalls (weiterhin) berücksichtigt werden. Digitale Spiele sind aus dem Alltag vieler Kinder und Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. Alle sollten die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben. Mit der vorliegenden Arbeit wurde eine umfangreiche Darstellung des digitalen Spielverhaltens sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher aufgezeigt, um Präferenzen, Gewohnheiten, Barrieren sowie Teilhabebeschränkungen hervorzuheben. Für weitergehende Studien könnten qualitative Forschungsarbeiten in Form von Interview- oder Beobachtungsstudien mit dem Fokus auf blinde und hochgradig sehbehinderte Spielerinnen und Spieler sinnvoll sein, da insbesondere diese Gruppen auf Herausforderungen beim digitalen Spielen treffen, welche noch wenig erforscht sind. Zukünftige Forschung ist in diesem Bereich essenziell, um das Thema „Teilhabe am digitalen Spielen“ in den Vordergrund zu rücken und die Spielindustrie auf Problematiken und Bedürfnisse beeinträchtigter Gruppen aufmerksamer zu machen. Nur so kann dem großen Ziel „Universal Game Design“ und einer gleichberechtigten Teilhabe an dieser Freizeitbeschäftigungsmöglichkeit nähergekommen werden.
Literatur
Aeppli, Jürg/Gasser, Luciano/Gutzwiller et al. (2016). Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Andrade, Ronny/Rogerson, Melissa J./Waycott et al. (2019). Playing Blind: Revealing the World of Gamers with Visual Impairment. CHI: Conference of Human Factors in Computing Systems 116, S. 1–14.
Bitkom. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (2020). Die Gaming-Trends 2021. Online verfügbar unter https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/BITKOM-Studie-Jung-und-vernetzt-2014.pdf.
Buaud, Aurélie/Svensson, Harry/Archambault, Dominique et al. (2002). Multimedia Games for visually impaired children. In: Klaus Miesenberger/Joachim Klaus/Wolfgang Zagler (Hg.). Computers helping people with special needs. 8th International Conference, ICCHP 2002. Berlin: Springer, S. 173–180.
Gameyard!: Liste von Gaming Genren. Online verfügbar unter https://www.gameyard.de/magazin/gaming-genre/ (abgerufen am 31.05.2023).
Liebal, Janine (2012). Inclusive Gaming – Spieleentwicklung neu denken! Eine Untersuchung zur Nutzung und Benutzbarkeit digitaler Spiele durch blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. In: Henning Brau/Andreas Lehmann/Kostanija Petrovic et al. (Hg.). Tagungsband UP12. Stuttgart: German UPA e. V., S. 126–131.
Lindmeier, Bettina/Bickes, Lara (2015). Freundschaften und Freizeitsituation von Jugendlichen mit einer Sehbeeinträchtigung. Zeitschrift für Heilpädagogik 66, S. 276–288.
LMZ. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg: Spielgenres und Plattformen. Online verfügbar unter https://www.lmz-bw.de/medienbildung/themen-von-a-bis-f/digitale-spiele/spielgenres-und-plattformen (abgerufen am 31.05.2023).
Markowetz, Reinhard (2009). Freizeiterziehung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen/Benachteiligungen. In: Roland Stein/Dagmar Orthmann Bless (Hg.). Private Lebensgestaltung bei Behinderungen und Benachteiligungen im Kindes- und Jugendalter. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 30–63.
MPFS. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (2020). JIM-Studie 2020. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Online verfügbar unter https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf (abgerufen am 18.01.20232).
Pohlmann, Horst (2007). Überwältigt von der Spieleflut? – Genrekunde. In: Winfried Kaminski/Tanja Wittning (Hg.). Digitale Spielräume: Basiswissen Computer- und Videospiele. München: kopaed, S. 9–16.
Porst, Rolf (2014). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch, 4. Aufl. Wiesbaden: Springer VS.
Preisinger, Alexander (2022). Digitale Spiele in der historisch-politischen Bildung. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag.
Wrzesińska, Magdalena Agnieszka/Tabala, Klaudia/Stecz, Patryk (2021). Gaming behaviors among polish students with visual impairment. International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (4), 1545, S. 1–12.

Catarina Fernandes Nunes
Pädagogische Hochschule Heidelberg