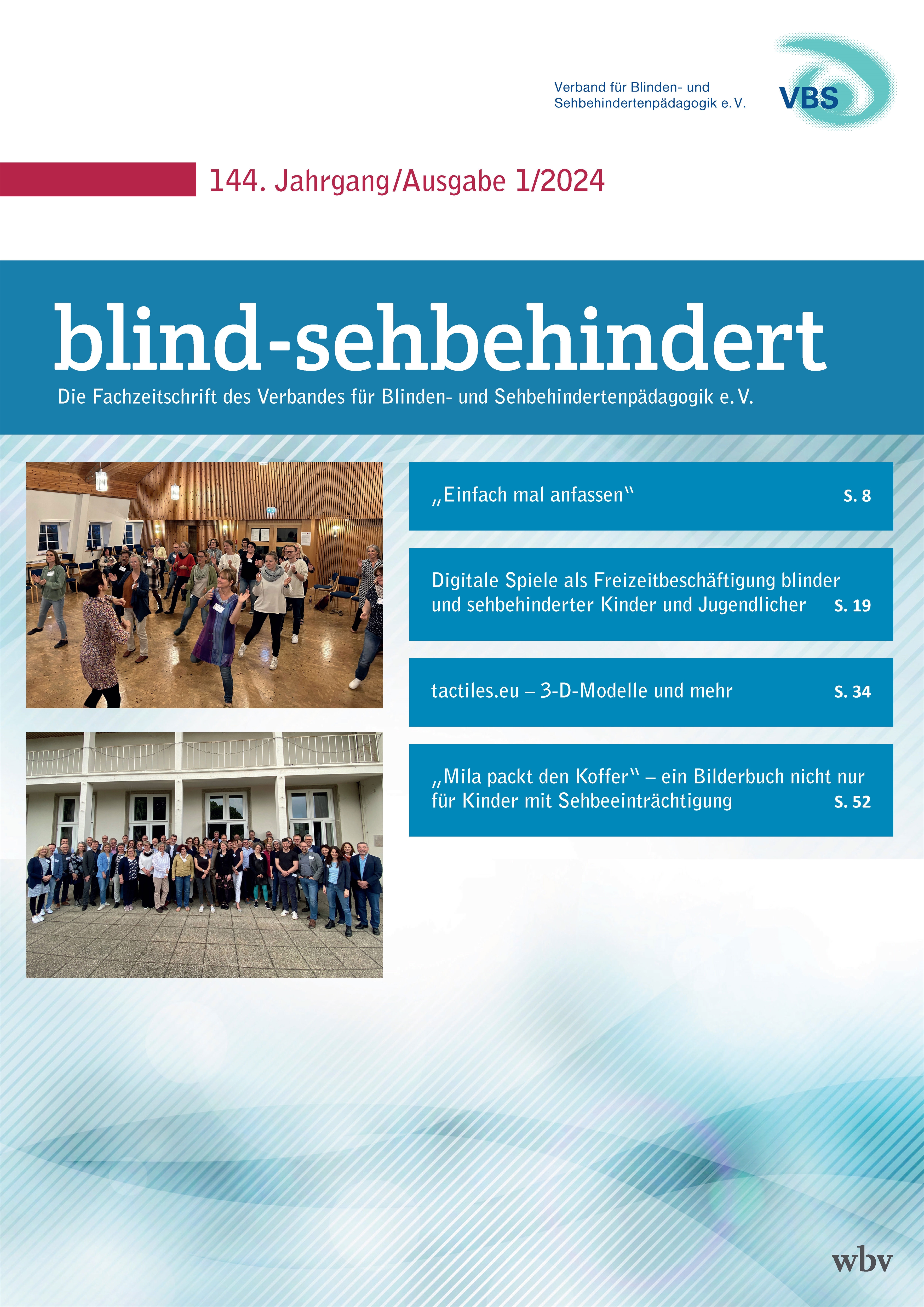„Einfach mal anfassen“
Sexualpädagogische Unterrichtspraxis mit blinden und sehbehinderten Schülern und Schülerinnen
1 Einleitung
Sexualität scheint in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig – sexuelle Bildung hingegen weniger. Dabei ist sie ein zentrales Instrument, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität zu erlernen und die vorhandene Informationsfülle besser strukturieren zu können. Auch innerhalb der Pädagogik ist sie ein Nischenthema. Noch nischiger wird es, wenn man sich mit der behinderungssensiblen Sexualpädagogik beschäftigt. Hier ist die empirische Befundlage im spezifischen Kontext von Blindheit und Sehbehinderung dann allenfalls noch als spärlich zu bezeichnen. Es stellt sich die Frage, ob dieser Informationsmangel dem Umstand geschuldet ist, dass Sexualität – wenngleich medial sehr präsent – paradoxerweise kein beliebter Gegenstand wissenschaftlicher Diskurse ist. Oder können sich Sehende bloß nicht vorstellen, dass Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung sexuelle Wesen sind? Vielleicht ist aber auch die blinde und sehbehinderte Sexualität gar nicht so anders als die sehende und bedarf insofern keiner gesonderten Betrachtung?
Die vorliegende Studie versucht, dieses empirische Defizit zumindest ein Stück weit auszugleichen, indem sie Lehrkräfte nach ihren Erfahrungen im sexualpädagogischen Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schüler*innen befragt. Die Untersuchung wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt.
1.1 Sexualität und sexuelle Sozialisation
Grundlegend für die folgenden Ausführungen ist das ganzheitliche Verständnis von Sexualität als „zentrale[m] Aspekt des Menschseins über die gesamte Lebensspanne hinweg“ (BZgA, 2011). Neben der gemeinhin damit assoziierten körperlichen Lust und Fortpflanzung umfasst sie weitere Aspekte wie das biologische Geschlecht, die Geschlechterrolle und -identität, sexuelle Orientierung, Beziehungen, Erotik und Intimität. Als angeborenes Potenzial kennt sie je nach Lebensalter und -situation ganz unterschiedliche Ausdrucksformen (Sielert, 2015). So lässt sich bereits im Säuglingsalter lustsuchendes Verhalten beobachten, wobei die Genitalien zentraler Bestandteil sein können, aber nicht müssen. Sexualität ist dabei als „diskursives Phänomen“ (Thuswald, 2021) und „soziale Tatsache“ (Sielert und Schmidt, 2013) zu verstehen; sie ist ein vom gesellschaftlichen Kontext abhängiges Konstrukt.
Relevant für diese Studie ist ferner die Differenzierung zwischen sex und gender. Ersteres bezieht sich auf das biologische Geschlecht, also eine bei der Geburt aufgrund primärer Geschlechtsmerkmale vorgenommene Zuweisung der Kategorie männlich oder weiblich. Zweiteres meint die soziokulturelle Ausprägung von Geschlecht, also den bewussten oder unbewussten performativen Geschlechterausdruck.
Die sexuelle Entwicklung bzw. Sozialisation beginnt mit der Geburt und ist hochgradig interaktiv. Die gesammelten Erfahrungen zwischenmenschlicher Vertrautheit oder autoerotischer Stimulation prägen dabei jeweils die kommenden Erfahrungen, sodass die „Bedürfnis-, Körper-, Beziehungs- und Geschlechtsgeschichte [...] bis ins Erwachsenenalter relevant bleiben“ (Wanzeck-Sielert, 2013).
All dies gilt auch für Menschen mit Behinderung. Bereits 1999 veröffentlichte die World Association for Sexual Health (WAS) die Erklärung der sexuellen Menschenrechte, welche u. a. die Rechte auf körperliche Unversehrtheit, sexuelle Privatsphäre, freie Partner*innenwahl, Gesundheitsfürsorge und den Zugang zu fundierter Sexualaufklärung beinhaltet (DGSS, n. d.). Dennoch wird Menschen mit Behinderung in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach ihre Sexualität abgesprochen (Köbsell, 2013). Wenn wir Inklusion als gesellschaftlichen Idealzustand anerkennen, muss auch der Lebensbereich der Sexualität darin einbegriffen sein.
1.2 Die Sexualität blinder und sehbehinderter Menschen
Hier sei zunächst auf die unzureichende empirische Befundlage in Bezug auf die sexuelle Sozialisation und das Ausleben von Sexualität bei blinden und sehbehinderten Menschen verwiesen. Die wenigen vorhandenen Studien kommen zu äußerst heterogenen Ergebnissen. Neben jenen, die eine ‚normale‘ sexuelle Aktivität attestieren (Bezerra und Pagliuca, 2010; Wienholz et al., 2016; Kelly und Kapperman, 2019), finden sich auch solche, die eine Verzögerung der sexuellen Aktivität verzeichnen (Kef und Bos, 2006), und solche, die eine Abweichung in einzelnen Bereichen nahelegen (Pinquart und Pfeiffer, 2012; Aslan et al., 2021). All dies erlaubt keine validen Rückschlüsse auf das Sexualverhalten von Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Es werden daher gängige sexuelle Entwicklungsmodelle und die Befundlage zu allgemeinen Entwicklungsbesonderheiten dieser Zielgruppe miteinander verglichen. Insgesamt ist dabei nicht von einer defizitären sexuellen Sozialisation auszugehen. Unterschiede in der Entwicklung können weitgehend kompensiert werden (Brambring, 2003; 2005): Kognitive Entwicklungsverzögerungen werden i. d. R. mit dem Erwerb sprachlicher Fähigkeiten ausgeglichen, fehlende visuelle Interaktion mit adäquaten anderweitigen Kommunikationsformen, visuelles Lernen mit geeigneten Lernmitteln usw. Problematisch wird es erst dann, wenn Bindungsdefizite (Kahle, 2016), fehlende Privatsphäre (Ortland, 2013), Tastscheu oder die unzureichende Vermittlungskompetenz von bspw. Eltern oder Lehrkräften die Entwicklung hemmen (Krupa und Esmail, 2019). Der einzige Entwicklungsbereich, dessen Forschungsergebnisse als eindeutig besorgniserregend gelten können, ist jener der Motivation und des Selbstbildes. Hier indiziert die empirische Befundlage ungünstige Kontrollüberzeugungen und Misserfolgsattribution sowie ein oftmals negativeres Selbstbild und größere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper (Pinquart und Pfeiffer, 2012; Elsman et al., 2019).
1.3 Die Bedeutsamkeit der sexuellen Bildung
Sexualpädagogische Information und Begleitung sind zunächst für alle Menschen, unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung, bedeutsam. Da sexuelle Entwicklung über die gesamte Lebensspanne hinweg stattfindet, ist ein früher Beginn sexueller Bildung, immer angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand, von größter Relevanz. Weitere Ansprüche an eine sexuelle Bildung, die sich aus den „Standards für die Sexualaufklärung in Europa“ der WHO ableiten lassen, sind u. a. deren Orientierung an den sexuellen Menschenrechten, die Offenheit für Vielfalt, respektvolles Miteinander und wissenschaftliche Korrektheit (BZgA, 2011). Ferner formuliert Valtl (2013) in seinen fünf Kennzeichen sexueller Bildung, diese sei „selbstbestimmt und lerner_innenorientiert, [...] konkret und brauchbar“, spreche den ganzen Menschen an, sie habe „einen Wert an sich“ und sei politisch. In der Zusammenschau der einschlägigen Literatur lassen sich folgende zentrale Kernthemen einer gelungenen sexuellen Bildung identifizieren:
- Kenntnisse über den menschlichen Körper + seine Veränderungen in der Pubertät
- Schwangerschaft, Geburt + Schwangerschaftskonflikt
- Sexuelle Orientierungen, geschlechtliche Identitäten (unter der Berücksichtigung der Trennung von sex und gender)
- Sprechen über Sexualität
- Lust, Begehren + Selbstbefriedigung
- Beziehungsgestaltung und Lebensplanung
- Verantwortungsvoller Umgang mit pornografischen Inhalten
- Verhütung und Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten
- Prävention sexuellen Missbrauchs und sexualisierter Gewalt
- Zugang zu Information und Beratungsstellen
Die Wirksamkeit sexualpädagogischer Bildungsangebote ist empirisch belegt. So wurden z. B. Effekte in Bezug auf ein positiveres Selbstbild und sexuelle Selbstwirksamkeit (Güdül Öz und Yangın, 2021), die Reduktion sexuell übertragbarer Krankheiten (Larsson et al., 2006) sowie eine erhöhte individuelle Lebensqualität verzeichnet (Krupa und Esmail, 2019). In Deutschland fehlt es allerdings bislang an einer hinreichenden Verankerung in Bildungsplänen oder in den Curricula der Lehrer*innenausbildung. Letzteres ist fatal, da der sexualpädagogische Unterricht besondere Fähigkeiten wie etwa Sprachkompetenzen, fachliche und juristische Kenntnisse, Feinfühligkeit und Selbstreflexion verlangt (König und Krem, 2021).
Alle genannten Punkte lassen sich auf die Bildung blinder und sehbehinderter Menschen übertragen. Jedoch bestehen gewisse zusätzliche Hindernisse, die, wenn unbeachtet, den sexualpädagogischen Lernerfolg beeinträchtigen können: die fehlende Möglichkeit visueller Informationsdarbietung, soziale Normen, die taktiles Lernen behindern, das Fehlen adäquater Materialien, die nicht ausreichende Vorbereitung von Lehrkräften oder Eltern sowie das Fehlen von nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten bei Menschen mit visueller Beeinträchtigung (Krupa und Esmail, 2019). In der Synthese dieser Erkenntnisse konnten drei Ebenen identifiziert werden, auf denen Anpassungen vorzunehmen sind: jene der Lerninhalte, der Didaktik und der Unterrichtsatmosphäre. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören z. B. die Förderung der nonverbalen Kommunikation (Krupa und Esmail, 2019) und der Begriffsbildung (Lang, 2017), exklusives „pre-teaching“ (Kelly und Kapperman, 2019), die Orientierung an alltagspraktischen Problemen sowie das Thema Behinderung und Sexualität (Ortland, 2013).
1.4 Forschungsfragen
Die Studie untersucht, wie Lehrkräfte sexualpädagogischen Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schüler*innen umsetzen. In diesem Sinne wird v. a. die individuelle Definition von Sexualität und sexueller Bildung in den Blick genommen. Ferner wird erhoben, wie die Befragten sexualpädagogischen Unterricht konkret gestalten und auf welchen Ebenen ihres Erachtens (Handlungs-)Bedarfe bestehen.
2 Methodik
Bei der Sexualität handelt es sich um ein Konstrukt, das im Denken, Handeln und Kommunizieren entsteht, weshalb ein qualitatives Verfahren für das vorliegende Forschungsvorhaben angemessen ist. Es geht v. a. um die Erfassung individueller Erfahrung und die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen, da diese als maßgeblich für die Umsetzung sexualpädagogischen Unterrichts gelten können.
2.1 Datenerhebung
Zur Datenerfassung wurden Expert*inneninterviews geführt. Als qualitative Interviews mit Teilstrukturierung durch einen Leitfaden erlauben diese ein hohes Maß an Steuerung durch die Befragten. Im Rahmen des Sampling-Prozesses wurden sonderpädagogische Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland kontaktiert. Die geringe Resonanz dieser Anfragen verdeutlicht dabei aufs Neue, dass es sich bei der Sexualpädagogik um ein herausforderndes Thema handelt.
Bei der Stichprobe (n = 4) handelt es sich um Lehrkräfte an blinden- und sehbehindertenpädagogischen Bildungseinrichtungen im Alter von 29–53 Jahren, die sich als weiblich identifizieren. Große Diversität besteht im Hinblick auf individuelle berufliche Werdegänge, Berufserfahrung in Jahren und unterrichtete Altersklassen (Grundschul- bis Berufsschulstufe). Die 45–60-minütigen Gespräche wurden telefonisch oder per Videocall geführt, aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert.
2.2 Auswertung
Die Auswertung mithilfe der Analysesoftware MAXQDA orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Auswertungskategorien wurden einerseits deduktiv auf Basis der theoretischen Vorarbeit sowie andererseits induktiv auf Grundlage des erhobenen Materials gebildet. Es wird gewährleistet, dass die Kategorien konkret definiert, trennscharf und erschöpfend sind.
3 Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang der gebildeten Oberkategorien. Ein Kodierleitfaden mit genauerer Aufschlüsselung der Ober- und Subkategorien sowie ausführliche Erklärungen und Interviewbeispiele finden sich in Schlesinger (2022).
3.1 Sexualität und sexuelle Bildung
Die befragten Lehrkräfte verfügen über ein differenziertes Sexualitätsverständnis. Mehrheitlich betonen sie die Mehrdimensionalität des Begriffs. Als Bestandteile von Sexualität werden biologisch-physiologische, soziale, emotionale, gesellschaftliche und politische Aspekte benannt. Keine der Befragten sieht einen Konflikt in dem Vorliegen einer Behinderung und dem Vorhandensein sexueller Interessen und Bedürfnisse. Die Befragten setzen jeweils individuelle Schwerpunkte; in Summe wurden folgende Aspekte des Gegenstandsbereichs der sexuellen Bildung benannt:
Tabelle 1: Gegenstandsbereich der sexuellen Bildung laut den Befragten
|
Themenbereich |
Unterthemen |
|---|---|
|
Kenntnis des Körpers |
Kenntnis und Benennung der Geschlechtsorgane, Gegenüberstellung weiblicher und männlicher Körper, Körperliche Veränderungen in der Pubertät, Menstruation und Verwendung von Hygieneartikeln, Schwangerschaft, Körperliche Lust und Selbstbefriedigung |
|
Identität |
Soziale Rollenbilder und Geschlechterrollen, Selbstbewusstsein |
|
Emotionale Aspekte |
Verliebtsein, ‚Praktische‘ Umsetzung: Kennenlernen, Dating, Treffen |
|
Selbstbestimmung |
Eigene Grenzen, Nähe und Distanz, Intimsphäre |
|
Sexualität und Behinderung |
Information über Unterstützungsansprüche, Sexualbegleitung und -assistenz |
|
Prävention |
Jugendschutz, Schutz vor sexuellen Übergriffen, Verhütung, (Gynäkologische) Vorsorgeuntersuchungen, Umgang mit Medien und Pornografie |
|
Rechte |
Privatsphäre, Verhütung und Elternschaft |
3.2 Schüler*innen mit Blindheit oder Sehbehinderung
Die Aussagen der Befragten zeichnen sich durch differenzierte Beobachtung und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen in die eigene Schüler*innenschaft aus. Maßgebliche Einflussfaktoren sind aus Sicht der Lehrkräfte die geringe Mobilität, das hohe Maß an Fremdbestimmung und das bisweilen veränderte Verhältnis zu Nähe und Distanz. Drei der vier Befragten schildern ein großes Interesse der Schüler*innen an sexualpädagogischen Themen sowie das Vorhandensein von sexueller Erfahrung und einem Vorwissen, welches vordergründig durch das Internet und Peers geprägt ist. Bezüglich der Frage, ob und inwiefern sich die Situation ihrer Zielgruppe mit der sehender Schüler*innen vergleichen lässt, sind die Befragten uneins; einig sind sie sich jedoch in dem Punkt, dass auch wenn von keinerlei sexuellen Beeinträchtigungen ausgegangen wird, didaktische Anpassungen im sexualpädagogischen Unterricht angebracht sind.
3.3 Unterrichtspraxis
Die genannten Aspekte zur blinden- und sehbehindertenspezifischen Gestaltung der Unterrichtspraxis lassen sich in drei Ebenen gliedern. (1) Hinsichtlich der Unterrichtsatmosphäre verweisen die Lehrkräfte mehrfach auf die positiven Effekte einer geringen Gruppengröße. Allgemein empfinden sie das Lernklima als offen und vertrauensvoll, was sie als wichtig für die Wirksamkeit erachten. (2) Auf inhaltlicher Ebene sehen sie die Notwendigkeit, einige zusätzliche behinderungsspezifische Lernfelder zu behandeln. Genannt werden hier Körper und Körpererfahrung, Selbstbestimmung und eigene Grenzen, soziale und emotionale Aspekte, Rechte, Sexualität und Behinderung, Abbau von Ängsten sowie Schutz und Prävention. (3) Auf methodisch-didaktischer Ebene ist zunächst die Lernenden- und Alltagsorientierung zu nennen. Inhalte seien gut zu strukturieren, wobei am Vorwissen anzusetzen und dieses in einen Bezugsrahmen zu setzen sei. Ferner sollten konkrete Alltagsprobleme behandelt werden, wie z. B. das Auffinden von Kondomen in der Drogerie, die Verwendung von Tampons oder der Umgang mit Dating-Apps. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sprache. Diese ist sowohl als Lerngegenstand (in Form der sexuellen Begriffsbildung, z. B. beim Erwerben der korrekten Bezeichnung von Geschlechtsorganen) als auch als didaktisches Mittel relevant (durch die große Bedeutung verbaler Informationsvermittlung). Auch die Verwendung adäquaten Materials gehört zu dieser Ebene. Die Lehrkräfte berichten von oftmals unangemessenen Lernmaterialien, z. B. aufgrund von Unübersichtlichkeit, falschen Proportionen, unpassender Haptik oder einer zu großen vorausgesetzten Abstraktionsleistung. Wichtige Kriterien für die Materialauswahl seien Strukturiertheit, Authentizität und ein möglichst großer Realitätsbezug. Auch betonen die Lehrkräfte die Bedeutung der Selbstexploration, welche oftmals durch soziale Restriktion gehemmt werde.
3.4 Akteur*innen
Als vorrangig relevante Akteur*innen der sexuellen Bildung konnten die Lehrkraft, die Erziehungsberechtigten und die Schule identifiziert werden. In Bezug auf die Lehrkraft sei auf deren Vorbildfunktion und die vielfältigen benötigten Kompetenzen verwiesen, die neben Selbstreflexion und Empathie auch etwa biologisches und juristisches Fachwissen umfassen. Der Schule kommt in diesem Zusammenhang eine Doppelfunktion zu (besonders, wenn der Schule – wie im Förderschwerpunkt Sehen nicht unüblich – ein Wohnbereich angegliedert ist): Sie ist einerseits ein physischer Ort, an dem soziale Begegnung stattfindet und an dem partnerschaftliche und sexuelle Erfahrung gesammelt wird; andererseits prägt sie als Institution maßgeblich den Handlungsrahmen, z. B. durch das Vorhandensein bzw. das Fehlen von pädagogischen Konzepten oder Weiterbildungsangeboten.
3.5 Bedarfe
Als Expert*innen der Unterrichtspraxis haben die Lehrkräfte einen differenzierten Blick auf allgemeine und konkrete Bedarfe im Sinne einer sexuellen Bildung aller. Dabei nennen sie auf gesellschaftlich-politischer Ebene eine Enttabuisierung von (behinderter) Sexualität sowie eine bessere Aufklärung von Menschen mit Behinderung über ihre Rechte (z. B. in Bezug auf Verhütung und Elternschaft). Kooperation innerhalb des Kollegiums sowie mit externen Stellen bewerten sie als gewinnbringend. Mehrheitlich kritisieren sie den oftmals zu späten Beginn und zu geringen zeitlichen Umfang sexualpädagogischer Bildungsangebote. Zudem brauche es mehr Initiative zur Prävention sexualisierter Gewalt gegenüber dieser Zielgruppe.
Auf institutioneller Ebene sehen sie die Notwendigkeit einer festen Verankerung sexualpädagogischer Lerninhalte im Bildungsplan sowie ebenfalls in der Lehrer*innen-Ausbildung. Zwar stellen sie fest, dass das Thema Sexualität gegenüber der Vergangenheit heute präsenter ist; es haben sich jedoch neue Herausforderungen, z. B. durch das Internet, ergeben.
4 Diskussion
4.1 Sexualität und sexuelle Bildung
Die vielen konkreten Situationen, welche die Befragten schildern, und die diversen Aspekte, die sie dem Themenfeld der Sexualität zuordnen, lassen auf ein differenziertes und behinderungssensibles Sexualitätsverständnis sowie eine erhebliche Relevanz im schulischen Alltag schließen. In Summe tragen die Aussagen der Vielschichtigkeit des Sexualitätsbegriffs Rechnung: Jedes einzelne der von der WAS definierten sexuellen Menschenrechte (DGSS, o. J.) findet sich in mindestens einem der Interviews wieder. Im Gegensatz zur einschlägigen Literatur scheinen die Befragten Sexualität jedoch weniger als etwas Konstruiertes zu verstehen – was eigentlich wichtig wäre, da sie in ihrer Arbeit Sexualität immer wieder aufs Neue selbst konstruieren.
Bei Übertragung der genannten thematischen Aspekte auf den in Kap 3.2 identifizierten Gegenstandsbereich der sexuellen Bildung ergibt sich die folgende Verteilung:
Tabelle 2: Nennung von Themenfeldern, aufgeschlüsselt nach Befragten
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kenntnis des Körpers und seiner Veränderungen in der Pubertät |
× |
× |
× |
× |
|
Schwangerschaft, Geburt und Schwangerschaftskonflikt |
× |
× |
× |
|
|
Sexuelle Orientierung, Geschlechteridentitäten |
||||
|
Sprechen über Sexualität |
× |
× |
× |
× |
|
Lust, Begehren und Selbstbefriedigung |
× |
× |
× |
|
|
Beziehungsgestaltung und Lebensplanung |
× |
× |
× |
|
|
Verantwortungsvoller Umgang mit pornografischen Inhalten |
× |
× |
||
|
Verhütung und Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten |
× |
× |
× |
|
|
Prävention sexuellen Missbrauchs und sexualisierter Gewalt |
× |
× |
× |
|
|
Zugang zu Informationen und Beratungsstellen |
× |
× |
Die individuelle Schwerpunktsetzung bzw. unterschiedliche Themenabdeckung durch die Lehrkräfte unterstreicht die Bedeutung von Kooperation im Bereich der Sexualpädagogik. Deutlich wird auch, dass das Thema „Sexuelle Orientierung, Geschlechteridentitäten“ von keiner der Befragten explizit benannt wird. Dies ist insb. deshalb problematisch, weil die Schule gesellschaftliche Werte, die sie vermittelt, automatisch legitimiert (Stobbe, 2021). Nicht nur wird dadurch die Adressierung von allen Teilen der Schüler*innenschaft verhindert, auch wird ferner nicht auf einen Abbau diskriminierender Strukturen hingewirkt. Die dramatischen Folgen für die besonders vulnerable Gruppe von LGBTIQ*-Schüler*innen sind hinreichend belegt (Klenk, 2023). Zudem ist festzuhalten, dass der Umfang und die Regelmäßigkeit von Lernangeboten gegenüber den Empfehlungen in der sexualpädagogischen Literatur deutlich zu gering ausfallen.
4.2 Schüler*innen mit Blindheit oder Sehbehinderung
Grundsätzlich ist auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen und der Aussagen der interviewten Lehrkräfte nicht von einer defizitären Sexualentwicklung auszugehen. Auch deutet nichts darauf hin, dass blinde oder sehbehinderte Menschen weniger oder grundlegend anders sexuell sein könnten als sehende. Dennoch konnten in dieser Studie Bereiche erhöhter Vulnerabilität identifiziert werden, welche im Kontext der sexuellen Bildung besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Dazu zählen die sozialen Beziehungen, die individuelle Mobilität, die Selbstbestimmung und das Selbstbild, die Repräsentation von Körpern, die Begriffsbildung und der Schutz vor sexualisierter Gewalt.
4.3 Unterrichtspraxis
Aus den zuvor umrissenen Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen resultieren auf Unterrichtsebene konkrete Maßnahmen, um die sexuelle Bildung behinderungssensibel und inklusiv zu gestalten. Diese sind, neben der inhaltlichen Erweiterung um behinderungsspezifische Lernfelder (Körper/Körpererfahrung, Selbstbestimmung/eigene Grenzen, soziale und emotionale Aspekte, Rechte, Sexualität und Behinderung, Abbau von Ängsten, Schutz/Prävention), vor allem didaktischer Natur. Ein Augenmerk sollte auf der lebenspraktischen Orientierung des Unterrichts liegen, der direkt am Vorwissen und an der Alltagserfahrung der Lernenden ansetzen sollte (Ortland, 2008). Der Sprache kommt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu; einerseits als Instrument der Wissensvermittlung, andererseits als Lerngegenstand im Sinne der Begriffsbildung (Lang, 2017). Auch in Bezug auf die Auswahl adäquaten Materials lassen sich die Ergebnisse sehr gut mit der fachrichtungsspezifischen Didaktik in Einklang bringen.
4.4 Akteur*innen
Die einschlägige Literatur und die Ergebnisse der Studie geben Recht zu der Annahme, dass die sexuelle Bildung maßgeblich geprägt wird durch die handelnden pädagogischen Akteur*innen und ihre (mitunter unbewussten) Werthaltungen und Sexualitätskonstruktionen. Dazu gehört zunächst die Lehrperson, deren Kompetenzanforderungen sehr umfassend sind: Es braucht kritische Selbstreflexion, Empathie, Authentizität, Fachwissen, eine Balance zwischen Vertrauen und professioneller Distanz sowie didaktische, methodische und juristische Kenntnisse. Ferner spielt die Schule eine entscheidende Rolle, gerade im Kontext von Blindheit und Sehbehinderung. Die Schule ist nicht nur ein Lernort, dessen Haltungen, Werte und institutioneller Rahmen das beeinflussen, was sexuelle Bildung vermittelt, sondern überdies ein Lebensort, der – insb. in sozialer Hinsicht – von fundamentaler Bedeutung für die Beziehungen und Aktivitäten der Schüler*innen ist.
4.5 Bedarfe
Bereits in den Vorrecherchen taten sich einige Missstände und Problembereiche auf, die durch die Befragten nicht nur bestätigt, sondern erweitert wurden. Dabei lassen sich die folgenden fünf dringlichsten Forderungen ableiten:
- Die Enttabuisierung und Normalisierung der Sexualität im Allgemeinen sowie der Sexualität behinderter Menschen im Speziellen
- Individuell unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Behinderungssensibilität als Dreh- und Angelpunkt aller inhaltlichen, methodischen und didaktischen Entscheidungen
- Die Aufklärung von Schüler*innen mit Blindheit oder Sehbehinderung über ihre Rechte, ihre Ansprüche auf Unterstützung und über den Zugang zu spezifischer Beratung
- Ausreichende Ressourcen und Fortbildungen für Schulen und pädagogische Fachkräfte (insb. zur Sensibilisierung hinsichtlich geschlechtlicher und sexueller Vielfalt)
- Die nötige Anerkennung der sexuellen Bildung als Fach, in Konzeptionen und in der pädagogischen Ausbildung
5 Fazit
Alle befragten Lehrkräfte verfügten über ein reflektiertes und behinderungssensibles Verständnis von Sexualität. In ihren Sexualitätskonstrukten, die in der Summe sehr differenziert waren, legten sie jeweils unterschiedliche individuelle Schwerpunkte. Dieser Umstand legt nahe, dass Schüler*innen davon profitieren, wenn Bildungsangebote nicht nur von einer einzelnen Person unterbreitet werden. In Bezug auf den Themenbereich Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierungen zeigte sich überdies, dass Sensibilisierung und Weiterbildung von Lehrkräften unbedingt vonnöten sind.
Hinsichtlich der Zielgruppe blinder und sehbehinderter Schüler*innen bestätigten die Aussagen der Befragten die Hypothese, dass nicht von einer ‚anderen‘ Sexualität auszugehen ist. Dennoch bedürfen die Bereiche erhöhter Vulnerabilität (Repräsentation des Körpers, Bindung, Selbstbestimmung und Privatsphäre, Peer-Beziehungen und soziale Rollen sowie v. a. Motivation und Selbstbild) besonderer Aufmerksamkeit. Um dem Rechnung zu tragen, gilt es, eine vertrauensvolle Lernatmosphäre zu schaffen sowie inhaltlich die zusätzlichen Themen Rechte, Selbstbestimmung und eigene Grenzen, Privatsphäre, soziale Aspekte und Peer-Beziehungen aufzugreifen. Methodisch-didaktisch müssen Inhalte in einen lebenspraktischen Kontext eingebunden, sprachlich differenziert begleitet und mithilfe adäquater und authentischer Materialien vermittelt werden.
Neben der Lehrkraft mit ihren umfassenden sexualpädagogischen Kompetenzanforderungen hat die Schule als sozialer Begegnungsort und konzeptioneller Handlungsrahmen erheblichen Einfluss auf die Qualität der sexuellen Bildung; insb. aufgrund der oftmals eingeschränkten Mobilität der Zielgruppe. Es ist davon auszugehen, dass Schüler*innen mit oder ohne visuelle Einschränkungen von einer flächendeckenderen sexuellen Bildung profitieren würden. In diesem Sinne braucht es neben entsprechenden finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen umfassende (Fort-)Bildungsangebote für Lehrkräfte und eine gesamtgesellschaftliche Enttabuisierung behinderter Sexualität.
5.1 Limitation
Insgesamt stehen die Ergebnisse der Studie im Einklang mit der einschlägigen Literatur. Das leitfadengestützte Expert*inneninterview ermöglichte eine inhaltliche Priorisierung durch die Interviewten; gleichzeitig ging dies mit einer eingeschränkten Vergleichbarkeit der Gespräche einher. Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte die Zuordnung aller Kernaussagen in mindestens eine passende Kategorie. Eine Mehrfachkodierung und -auswertung durch weitere Personen könnte hier zu mehr Objektivität beitragen. Trotz der geringen Größe konnte eine hinsichtlich der Persönlichkeitsvariablen relativ heterogene Stichprobe erreicht werden. Es sei jedoch angemerkt, dass diese Studie v. a. die Perspektiven überdurchschnittlich engagierter Lehrkräfte erfasst. Um ein realistischeres Bild des schulischen Alltags zu zeichnen, müssten auch die Sichtweisen von Lehrpersonen erhoben werden, die sich weniger für sexuelle Bildung interessieren. Zudem fehlen Teilnehmer*innen, die in der Inklusion an Regelschulen tätig sind.
Zuletzt sei die Perspektive der Verfasserin (sexualpädagogisch engagiert, weiß, nicht-behindert, cis-gender) bemerkt. Gerade bei einer Untersuchung, die sich mit den Lebensumständen und Bedürfnissen blinder und sehbehinderter Menschen befasst, wäre es zu begrüßen, wenn sie aus einer ebensolchen Position verfasst würde.
5.2 Ausblick
Die Studie bietet Anlass zur empirischen Vertiefung und Erweiterung. So könnte neben der kategorienbasierten auch eine fallbasierte Auswertung des Materials vorgenommen werden, um bspw. die Auswirkungen des individuellen Sexualitätskonstrukts auf die Unterrichtsqualität zu untersuchen. Des Weiteren könnte die Erfassung der Sichtweisen der Schüler*innen auf ihre Lebensumstände, Bedürfnisse und Sexualität Aufschluss geben über die Zusammenhänge zwischen den unterrichteten Altersgruppen, Interessen, dem spezifischen Vorwissen oder der Mediennutzung. Alles in allem erscheint wünschenswert, dass sich zukünftig mehr Forschende mit der Sexualpädagogik, insb. der behinderungsspezifischen, befassen, damit allen Menschen eine passgenaue sexuelle Bildung zuteilwerden kann. Dies und eine größere gesellschaftliche Anerkennung des Themas können dazu beitragen, dass Menschen ihre Sexualität frei und verantwortungsvoll leben können. Zuletzt bleibt auf mehr Publikationen aus Betroffenenperspektive zu hoffen und darauf, dass der öffentliche Diskurs von Menschen mit Behinderung und ihrer Sicht der Dinge geprägt wird, damit wir fortan weniger über Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung sprechen, sondern mit ihnen – als den eigentlichen Expert*innen ihrer Lebensumstände und ihrer Sexualität.
Literatur
Aslan, Ergül/Yılmaz, Büşra/Acar, Zehra (2021). Reproductive Health, Sexual Function and Satisfaction Levels in Women with Physical, Hearing, and Visual Disabilities. Sexuality and Disability 39 (3), 595–608. Online verfügbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-021-09690-3
Bezerra, Camilla Pontes/Pagliuca, Lorita Marlena Freitag (2010). The experience of sexuality by visually impaired adolescents. Revista da Escola de Enfermagem 44 (3), 578–583.
Brambring, Michael (2003). Sprachentwicklung blinder Kinder. In: Gert Rickheit/Theo Herrmann/Werner Deutsch (Hg.). Psycholinguistik. Ein internationales Handbuch. Berlin, de Gruyter, 730–752.
Brambring, Michael (2005). Divergente Entwicklung blinder und sehender Kinder in vier Entwicklungsbereichen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 37 (4), 173–183.
BZgA (2011). Standards für die Sexualaufklärung in Europa [Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten]. Köln, BZgA.
DGSS (o. J.). Erklärung der sexuellen Menschenrechte. Online verfügbar unter http://www.sexologie.org/sexualrechte.htm
Elsman, Ellen Bernadette Maria/van Rens, Gerardus Hermanus Maria Bartholomeus/van Nispen, R. M. A. (2019). Quality of life and participation of young adults with a visual impairment aged 18–25 years: comparison with population norms. Acta Ophtalmol 97 (2), 165–172. Online verfügbar unter https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30207073/
Güdül Öz, Hatice/Yangın, Hatice Balcı (2021). Evaluation of a Web-Based Sexual Health Education Program for Individuals with Visual Impairments. Sexuality and Disability 39 (4), 715–730. Online verfügbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-021-09692-1
Kahle, Ann-Kathrin (2016). Sexualität und Vielfalt – Muss man Sexualität lernen?. In: Anja Henningsen/Elisabeth Tuider/Stefan Timmermanns (Hg.). Sexualpädagogik kontrovers. Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 89–104.
Kef, Sabina/Bos, Henny (2006). Is love blind? Sexual Behavior and Psychological Adjustment of Asolescents with Blindness. Sexuality and Disability 24 (2), 89–100. Online verfügbar unter https://www.deepdyve.com/lp/springer-journals/is-love-blind-sexual-behavior-and-psychological-adjustment-of-Ul2CtDUF3Y
Kelly, Stacy M./Kapperman, Gaylen (2019). Sexual Activity of Young Adults who are Visually Impaired and the Need for Effective Sex Education. Journal of Visual Impairment & Blindness 106 (9), 519–526. Online verfügbar unter https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0145482X1210600903
Klenk, Florian Cristobal (2023). Post-Heteronormativität und Schule [Soziale Deutungsmuster von Lehrkräften über vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen]. Opladen/Berlin/Toronto, Verlag Barbara Budrich.
Köbsell, Swantje (2013). Sex – (K)Ein Thema? [Über die Schwierigkeiten politisch engagierter behinderter Frauen und Männer, das Begehren zu thematisieren]. In: Jens Clausen/Frank Herrath (Hg.). Sexualität leben ohne Behinderung. Stuttgart, Kohlhammer, 124–134.
König, Heidemarie/Krem, Adriane (2021). Rechtliche Aspekte in der Sexualpädagogik. In: Marion Thuswald/Elisabeth Sattler (Hg.). Sexualität, Körperlichkeit, Intimität. Bielefeld, transcript, 357–374.
Krupa, Chelsea/Esmail, Shaniff (2019). Sexual Health Education for Children with Visual Impairments: Talking about Sex is not Enough. Journal of Visual Impairment & Blindness 104 (6), 327–337. Online verfügbar unter https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0145482X1010400603
Lang, Markus (2017). Wahrnehmungsförderung und Begriffsbildung als fächerübergreifende Prinzipien des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In: Markus Lang/Ursula Hofer/Friederike Beyer (Hg.). Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band I: Grundlagen. Stuttgart, Kohlhammer, 228–275.
Larsson, Margareta/Eurenius, Karin/Westerling, Ragnar et al. (2006). Evalutation of a sexual education intervention among Swedish high school students. Scandinavian Journal of Public Health 34 (2), 124–131. Online verfügbar unter https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/14034940510032266
Ortland, Barbara (2008). Behinderung und Sexualität [Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik]. Stuttgart, Kohlhammer.
Ortland, Barbara (2013). „Es wurde einfach nicht darüber gesprochen“ [Sexualerziehung mit Menschen mit Behinderung als notwendiges schulisches Gesamtkonzept]. In: Jens Clausen/Frank Herrath (Hg.). Sexualität leben ohne Behinderung. Stuttgart, Kohlhammer.
Pinquart, Martin/Pfeiffer, Jens P. ( 2012). What is essential is invisible to the eye [Intimate relationships of adolescents with visual impairment]. Sexuality and Disability 30 (2), 139–147.
Schlesinger, Louisa (2022). Die praktische Umsetzung sexualpädagogischer Inhalte im Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schüler:innen [Unveröffentlichte Masterarbeit]. Pädagogische Hochschule Heidelberg.
Sielert, Uwe (2015). Einführung in die Sexualpädagogik. Weinheim/Basel, Beltz.
Sielert, Uwe/Schmidt, Renate-Berenike (2013). Einleitung [Eine Profession kommt in die Jahre]. In: Renate-Berenike Schmidt/Uwe Sielert (Hg.). Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 11–24.
Stobbe, Milan (2021). Critical Cisness [Eine hegemoniale Selbstreflexion für Lehrer und Lehrerinnen]. In: Anette Vanagas (Hg.). Sexualpädagogische (Re)Visionen. Wiesbaden, Springer, 17–48.
Thuswald, Marion( 2021). Wie über Seuxalität sprechen? [Zur Lust auf Begriffsarbeit in der sexualpädagogischen Praxis]. In: Marion Thuswald/Elisabeth Sattler (Hg.). Sexualität, Körperlichkeit, Intimität. Bielefeld, transcript, 95–121.
Valtl, Karlheinz (2013). Sexuelle Bildung: Neues Paradigma einer Sexualpädagogik für alle Lebensalter. In: Renate-Berenike Schmidt/Uwe Sielert (Hg.). Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 125–140.
Wanzeck-Sielert, Christa (2013). Sexualität im Kindesalter. In: Renate-Berenike Schmidt/Uwe Sielert (Hg.). Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 355–363.
Wienholz, Sabine/Seidel, Anja/Michel, Marion et al. (2016). Sexual Experiences of Adolescents With and Without Disabilities: Results from a Cross-Sectional Study. Sexuality and Disability 34 (2), 171–182. Online verfügbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-016-9433-0