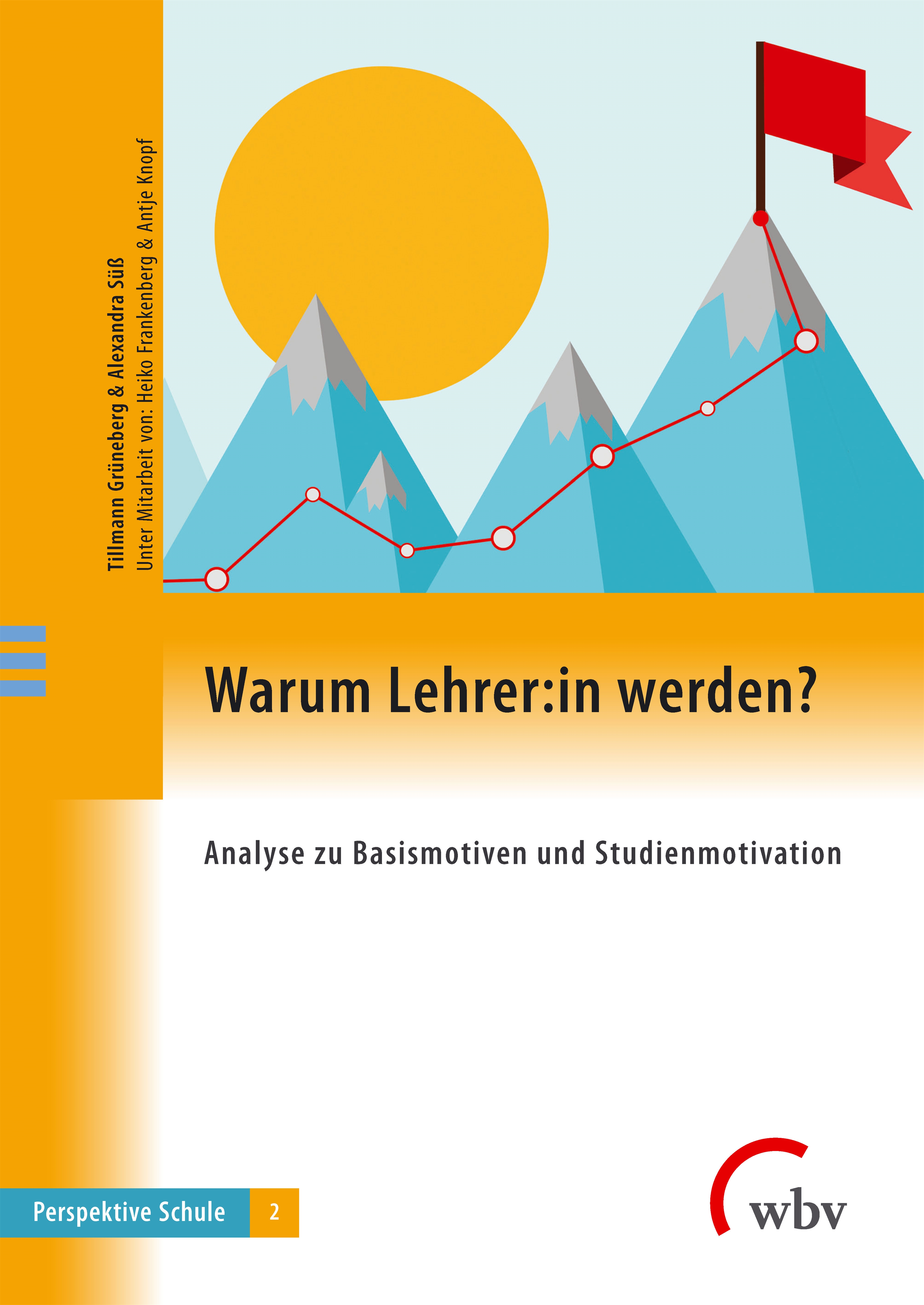Warum Lehrer:in werden?
Analyse zu Basismotiven und Studienmotivation
Der anhaltende Lehrkräftemangel wirft Fragen zur Berufszufriedenheit und Gesundheit im Lehramt auf. Die Studie knüpft an bestehende Untersuchungen zur Studien- und Berufswahl von Lehrkräften an und erhebt erstmals Daten zu den sogenannten Basismotiven. Das Anschlussmotiv zeigt sich im Streben nach sozialen Beziehungen, das Leistungsmotiv beschreibt das Bedürfnis nach Kompetenzsteigerung und Vergleich und das Machtmotiv ist durch Verantwortungsübernahme und Führung geprägt.
Mithilfe der Messverfahren Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) und Operanter Motivtest (OMT) werden sowohl bewusste als auch unbewusste Beweggründe von Lehramtsstudierenden erhoben und verglichen. Die Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) ermöglicht konkrete Ansätze für die Studien- und Berufsberatung und der professionellen Selbstreflexion.
Mithilfe der Messverfahren Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) und Operanter Motivtest (OMT) werden sowohl bewusste als auch unbewusste Beweggründe von Lehramtsstudierenden erhoben und verglichen. Die Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) ermöglicht konkrete Ansätze für die Studien- und Berufsberatung und der professionellen Selbstreflexion.
1.Vorworte und Danksagung
2.Einleitung
3.Vorstudien: Studienmotivation im Lehramt
3.1.Methode
3.2.Stichprobe
3.3.Ergebnisse
3.3.1.Gründe und Einstellungen zur Wahl des Lehramtsstudiums
3.3.2.Gründe der Studienwahl
3.3.3.Emotionales Erleben der Studienwahl
3.3.4.Entscheidungssicherheit und -zufriedenheit
3.3.5.Schulformwahl und Schulformflexibilität
3.3.6.Aspekte der Studienwahl
3.3.7.Wünsche und Vorstellungen vom/an das Lehramtsstudium
3.3.8.Aktuelle Studienmotivation
3.4.Zusammenfassung und Zwischenfazit
4.Von vorherigen Studien über die Vorstudie zur Vertiefungsstudie
5.Vertiefungsstudie: Motive und Motivstrukturen von Lehramtsstudierenden zu Beginn des Studiums
5.1.Theoretischer Hintergrund
5.1.1.Darstellung nationaler und internationaler Hauptdiskurslinien: Forschungstradition zu Studien- und Berufswahlmotiven von (angehenden) Lehrpersonen
5.1.2.Das Motivkonstrukt
5.1.3.Exkurs: Begriffliche Abgrenzungen
5.1.4.Der ideale Lehrer: Persönlichkeitseigenschaften und Motive von Lehramtsstudierenden sowie Berufswahlmotive von (angehenden) Lehrer:innen
5.1.5.Aktualisierung des Forschungsstandes zu Persönlichkeitseigenschaften von (angehenden) Lehrer:innen
5.2.PSI-Theorie
5.2.1.Die vier Hauptfunktionen der willentlichen Handlungssteuerung
5.2.2.Basismotive
5.2.3.Die 5 Motivmodi aktiver Formen der Bedürfnisbefriedigung
5.2.4.Anwendung der Motivtypen und -modi auf die drei Basismotive Anschluss, Leistung und Macht
5.3.Hypothesen und forschungsleitende Fragestellung
5.4.Methodisches Vorgehen
5.4.1.Einsatz der Testverfahren MUT und OMT
5.4.2.Stichprobenbeschreibung und Durchführung
5.4.3.Auswertungsgespräche - Konzeption und Durchführung
5.4.4.Auswertung - Kategoriensysteme
5.5.Ergebnisse der Vertiefungsstudie
5.5.1.Statistische Auswertung - Vergleich der MUT- und OMT-Ergebnisse
5.5.2.Überblick über die von den Interviewten beschriebenen Motivaspekte
5.5.3.Kategoriensystem Studienmotivation
5.5.4.Kategoriensysteme zum Lehrer:innenideal
5.5.5.Kategorisierungen zur Macht
5.5.6.Kategoriensystem Gesprächsfazit
5.6.Zusammenfassung und Zwischenfazit
6.Vertiefender Exkurs: Die PSI-Theorie als Basis für Hypothesen in der Beratung (von Heiko Frankenberg)
6.1.Die sieben Ebenen der Persönlichkeit am Beispiel Studienwahl und -bewältigung
6.2.Das Symptomentstehungsmodell
7.Praktische Anwendungsmöglichkeiten
7.1.Anwendung in der Beratung Studieninteressierter
7.1.1.Anwendung in Fragebögen und Tests
7.1.2.Motive in der Studienberatung
7.1.3.Als Übung im Rahmen des ZRM
7.1.4.Als Selbstreflexionsübung
7.2.Beratung von Studienzweifler:innen und Abbrecher:innen
7.3.Direkte Verwendung von MUT/OMT in der Beratung
7.4.Thematisierung und Nutzung der Motivtheorie im Studium
7.5.Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
8.Diskussion und Desiderata
9.Quellen
10.Anhang
2.Einleitung
3.Vorstudien: Studienmotivation im Lehramt
3.1.Methode
3.2.Stichprobe
3.3.Ergebnisse
3.3.1.Gründe und Einstellungen zur Wahl des Lehramtsstudiums
3.3.2.Gründe der Studienwahl
3.3.3.Emotionales Erleben der Studienwahl
3.3.4.Entscheidungssicherheit und -zufriedenheit
3.3.5.Schulformwahl und Schulformflexibilität
3.3.6.Aspekte der Studienwahl
3.3.7.Wünsche und Vorstellungen vom/an das Lehramtsstudium
3.3.8.Aktuelle Studienmotivation
3.4.Zusammenfassung und Zwischenfazit
4.Von vorherigen Studien über die Vorstudie zur Vertiefungsstudie
5.Vertiefungsstudie: Motive und Motivstrukturen von Lehramtsstudierenden zu Beginn des Studiums
5.1.Theoretischer Hintergrund
5.1.1.Darstellung nationaler und internationaler Hauptdiskurslinien: Forschungstradition zu Studien- und Berufswahlmotiven von (angehenden) Lehrpersonen
5.1.2.Das Motivkonstrukt
5.1.3.Exkurs: Begriffliche Abgrenzungen
5.1.4.Der ideale Lehrer: Persönlichkeitseigenschaften und Motive von Lehramtsstudierenden sowie Berufswahlmotive von (angehenden) Lehrer:innen
5.1.5.Aktualisierung des Forschungsstandes zu Persönlichkeitseigenschaften von (angehenden) Lehrer:innen
5.2.PSI-Theorie
5.2.1.Die vier Hauptfunktionen der willentlichen Handlungssteuerung
5.2.2.Basismotive
5.2.3.Die 5 Motivmodi aktiver Formen der Bedürfnisbefriedigung
5.2.4.Anwendung der Motivtypen und -modi auf die drei Basismotive Anschluss, Leistung und Macht
5.3.Hypothesen und forschungsleitende Fragestellung
5.4.Methodisches Vorgehen
5.4.1.Einsatz der Testverfahren MUT und OMT
5.4.2.Stichprobenbeschreibung und Durchführung
5.4.3.Auswertungsgespräche - Konzeption und Durchführung
5.4.4.Auswertung - Kategoriensysteme
5.5.Ergebnisse der Vertiefungsstudie
5.5.1.Statistische Auswertung - Vergleich der MUT- und OMT-Ergebnisse
5.5.2.Überblick über die von den Interviewten beschriebenen Motivaspekte
5.5.3.Kategoriensystem Studienmotivation
5.5.4.Kategoriensysteme zum Lehrer:innenideal
5.5.5.Kategorisierungen zur Macht
5.5.6.Kategoriensystem Gesprächsfazit
5.6.Zusammenfassung und Zwischenfazit
6.Vertiefender Exkurs: Die PSI-Theorie als Basis für Hypothesen in der Beratung (von Heiko Frankenberg)
6.1.Die sieben Ebenen der Persönlichkeit am Beispiel Studienwahl und -bewältigung
6.2.Das Symptomentstehungsmodell
7.Praktische Anwendungsmöglichkeiten
7.1.Anwendung in der Beratung Studieninteressierter
7.1.1.Anwendung in Fragebögen und Tests
7.1.2.Motive in der Studienberatung
7.1.3.Als Übung im Rahmen des ZRM
7.1.4.Als Selbstreflexionsübung
7.2.Beratung von Studienzweifler:innen und Abbrecher:innen
7.3.Direkte Verwendung von MUT/OMT in der Beratung
7.4.Thematisierung und Nutzung der Motivtheorie im Studium
7.5.Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
8.Diskussion und Desiderata
9.Quellen
10.Anhang
Tillmann Grüneberg (Jg. 1988) ist wissenschaftliche Lehrkraft an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und Lehrbeauftragter an der Universität Leipzig. Er ist zudem Systemischer Berater und Therapeut, Trainer in der beruflichen Bildung und Lehrerbildung sowie Geschäftsführer des Start-ups Begabungsvielfalt UG. Seine Forschungsschwerpunkte sind Berufs- und Studienberatung, Begabungsvielfalt und Multipotenzialität und Digitales Lehren und Lernen.
Alexandra Süß (Jg. 1989) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Studienberatung und -koordination des Masterstudiengangs Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung sowie Lehrunterstützung im Rahmen des Masterprogramms Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung an der Universität Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Begabungsforschung, Individuelle Persönlichkeitsentwicklung und Förderung/Personalisierte Entwicklungsplanung.
Alexandra Süß (Jg. 1989) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Studienberatung und -koordination des Masterstudiengangs Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung sowie Lehrunterstützung im Rahmen des Masterprogramms Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung an der Universität Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Begabungsforschung, Individuelle Persönlichkeitsentwicklung und Förderung/Personalisierte Entwicklungsplanung.