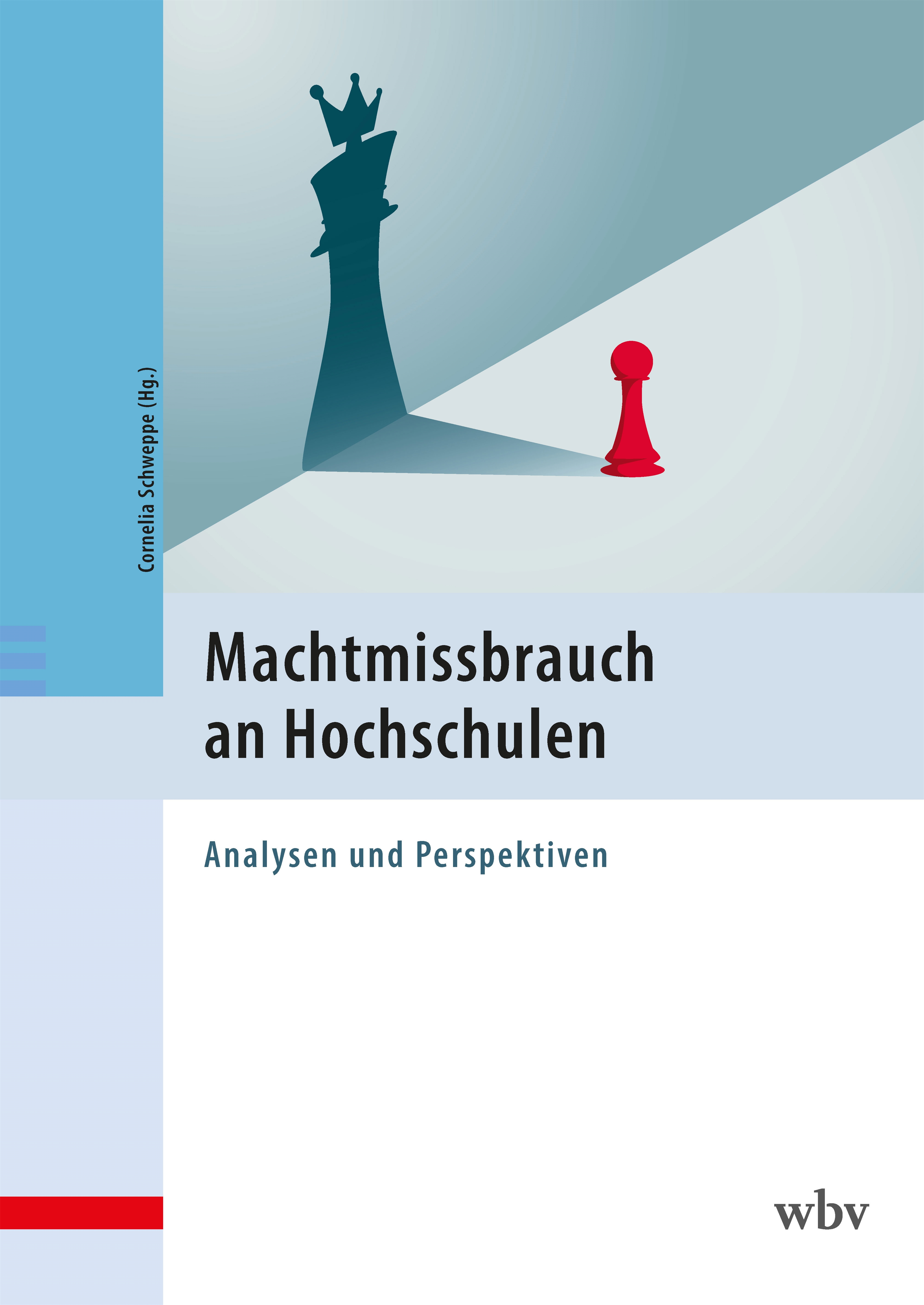Wo Machtfülle auf Abhängigkeiten trifft, ist Machtmissbrauch der sprichwörtliche Elefant im Raum: Viele wissen es, wenige sprechen darüber. Das gilt auch für deutsche Hochschulen. Prof.in Cornelia Schweppe hat ein wegweisendes Buch dazu publiziert und mit wbv über Mechanismen von und Maßnahmen gegen Machtmissbrauch gesprochen.
Wie verbreitet ist Machtmissbrauch?
Machtmissbrauch an Hochschulen ist kein Einzelphänomen. Er ist ein relativ verbreitetes und strukturell verankertes, systemimmanentes Problem. Allerdings ist nur ein kleiner Teil sichtbar. Der Großteil ist verdeckt und wird verschwiegen. Die wenigsten Vorfälle werden gemeldet und aufgeklärt.
Welche Formen von Machtmissbrauch begegnen Studierenden und Mitarbeitenden im akademischen Alltag?
Machtmissbrauch kann viele Formen annehmen: Mobbing, Demütigungen, Schikane, Nötigungen, Stalking, Intrigen, sexuelle Übergriffe, Gaslighting, die unzulässige Übertragung von Aufgaben, die unrechtmäßige Aneignung ihres geistigen Eigentums und viele mehr.
Welche Folgen hat Machtmissbrauch für die Betroffenen?
Die Folgen sind schwerwiegend. Erhebliche Belastungen und Gefährdungen der psychischen und physischen Gesundheit sind oft die Folge. Machtmissbrauch kann ebenso erhebliche Auswirkungen auf wissenschaftliche bzw. berufliche Karrierewege haben, gerade für wissenschaftliche Mitarbeitende; nicht selten verlassen sie das Wissenschaftssystem.
Welche Mechanismen oder Strukturen an Hochschulen begünstigen Machtmissbrauch?
Die Bedingungen und Ursachen sind komplex und vielschichtig. Sie sind tief in den Strukturen des Wissenschaftssystems verankert, das auf vielfältige Weise zu Machtmissbrauch geradezu einlädt. Die Machtfülle von Professor:innen und das erhebliche Machtgefälle zwischen ihnen und anderen Beschäftigten und Studierenden sowie die damit einhergehenden Abhängigkeiten von Mitarbeitenden sind ein bedeutender Teil dieser begünstigenden Strukturen. Sie resultieren aus der am Lehrstuhlmodell ausgerichteten Organisation des deutschen Wissenschaftssystems. Mitarbeiter:innenstellen (wissenschaftliche Mitarbeitende, nichtwissenschaftliches Personal und studentische Mitarbeitende) sind in der Regel direkt Professor:innen zugeordnet. Die Macht von Professor:innen gegenüber Mitarbeitenden ist groß und akzentuiert sich gegenüber wissenschaftlichen Mitarbeitenden durch die Bündelung dreier Funktionen: Professor:innen sind ihnen gegenüber gleichzeitig Vorgesetzte mit Personalverantwortung sowie Betreuende und Gutachtende ihrer Dissertationen. Dadurch entscheiden sie (weitgehend allein) über Einstellung, Vertragsverlängerung, Aufgabenverteilung sowie über Betreuung und Begutachtung der Dissertationen und üben so eine erhebliche Macht über ihre Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitsbedingungen und wissenschaftlichen Karrieren aus. Kontrollen über das Verhalten von Professor:innen gegenüber Mitarbeitenden gibt es kaum.
Die gegenwärtigen metrischen Bewertungskriterien wissenschaftlicher Leistung sind ein weiteres Einfallstor für Machtmissbrauch (Bössel u. a. 2022). Die Anzahl von Publikationen, Zitationskennzahlen (z. B. h-Index, Impact Factor von Zeitschriften) und natürlich Drittmittel sind zentral für die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen. Je mehr davon vorhanden ist, desto besser werden in der Regel die wissenschaftlichen Leistungen bewertet. Die Inhalte und Qualität der Forschung spielen bei diesen Bewertungskriterien – wenn überhaupt – oft nur eine untergeordnete Rolle. Diese Bewertungskriterien und der dadurch entstehende Druck können unethische Praktiken und Machtmissbrauch fördern, um möglichst schnell viele solcher Indikatoren vermeintlich guter wissenschaftlicher Leistungen zusammenzutragen und sich Vorteile im Konkurrenzkampf der Wissenschaft zu verschaffen. Solche Praktiken bleiben oft unentdeckt. Die gut funktionierenden Verdeckungszusammenhänge von Machtmissbrauch zeigen hier ihre Wirkung (s. u.).
Machtmissbrauch lässt sich jedoch nicht allein durch die strukturellen Bedingungen des Wissenschaftssystems erklären. Personenbezogene Faktoren kommen als Nährboden hinzu (Leising u. a. 2025), denn es braucht Personen, die ihn ausüben. Personenbezogene Faktoren werden in der bisherigen Debatte um Machtmissbrauch noch wenig berücksichtigt. Aber es ist bekannt: Bestimmte Persönlichkeitsdispositionen – gerade im Zusammenspiel mit den strukturellen Eigenschaften des Wissenschaftssystems – können das Risiko von Machtmissbrauch erhöhen: Narzissmus, Psychopathie, Machiavellismus, das rücksichtslose Verfolgen eigener Interessen auf Kosten anderer und Skrupellosigkeit gehören dazu. Es sind jene Persönlichkeitszüge, die in der Persönlichkeitspsychologie als der „dunkle“ Persönlichkeitsfaktor bezeichnet werden (Moshagen et al. 2018; Leising et al. 2025). Ulrich Dirnagl schreibt treffend: „Die Kombination aus steilen Hierarchien und einzelnen oder gleich mehreren „Dark Traits“ im Führungspersonal schafft den perfekten Nährboden für Machtmissbrauch“ (Dirnagl o. J.). Gleichzeitig sind diese Persönlichkeitseigenschaften keineswegs kontraproduktiv für die wissenschaftliche Karriere. Im Gegenteil: Personen mit diesen „dunklen“ Persönlichkeitszügen sind nicht selten „erfolgreich“ in der Wissenschaft. Das macht sie durchaus attraktiv für Hochschulen. Denn ihre „Erfolge“ können auch die „Erfolgsbilanz“ von Hochschulen positiv beeinflussen, indem sie zur Verbesserung der prestigeträchtigen Drittmittelbilanz einer Universität oder anderer renommeeträchtiger Indikatoren beitragen.
Machtmissbrauch findet sein Fundament ebenso in seinen Verdeckungszusammenhängen, die ihn permanent reproduzieren lassen. Das Problem wird oft verschwiegen, hartnäckig abgewehrt, Täter:innen werden geschützt; Aufklärungen treffen auf erhebliche Resistenzen. Diese Verdeckungen haben durchaus System. Nicht selten haben Hochschulen ein Interesse daran, dass Machtmissbrauch verschwiegen wird. Die Befürchtungen vor Rufschädigung durch das Bekanntwerden von Machtmissbrauch sind groß. Zudem: Abhängigkeiten sind keine guten Voraussetzungen, Machtmissbrauch sichtbar zu machen bzw. ihn bei entsprechenden Anlaufstellen zu melden. Die Angst vor negativen Konsequenzen ist groß und bei wissenschaftlichen Mitarbeitenden ist es vor allem auch die Angst vor Beeinträchtigungen ihrer wissenschaftlichen Karriere: Angst, ihr Vertrag könne nicht verlängert werden, Angst vor negativen Folgen für die Qualifizierungsarbeit und vieles mehr. Der mangelnde Bekanntheitsgrad, mangelndes Vertrauen, Angst vor mangelnder Anonymität oder intransparente Beschwerdewege sind ebenso Gründe, dass Anlaufstellen oft nur von einem recht kleinen Teil in Anspruch genommen werden. Ein wegschauendes und schweigendes, zum Teil mitspielendes Umfeld ist ein weiterer Grund für die Verdeckung von Machtmissbrauch.
Aber selbst wenn die Hürden genommen werden, einen Fall zu melden, sind die Reaktionen des Hochschulsystems oft ernüchternd. Gemeldete Fälle werden oder können oft nicht weiterverfolgt oder aufgeklärt werden. Zuweilen wird das Problem bagatellisiert. Zuständige Instanzen sind in ihren Handlungsmöglichkeiten oft eingeschränkt. Sanktionen gegen machtmissbräuchliches Verhalten sind selten. Oft können die Täter:innen ungehindert ihre Karriere fortsetzen.
Machtmissbrauch an Hochschulen ist so in einem fatalen Teufelskreis eingebunden. Indem er weitgehend unsichtbar ist, kaum verfolgt wird und kaum Konsequenzen nach sich zieht, kann sich Machtmissbrauch oft ungehindert und ungestört fortsetzen.
Welche Maßnahmen oder Veränderungen halten Sie für notwendig, um Machtmissbrauch an Hochschulen wirksam einzudämmen?
Machtmissbrauch ist komplex und vielschichtig; keine einzelne Maßnahme wird das Problem lösen. Es braucht größere, grundlegende Strukturveränderungen, aber auch kleinere Maßnahmen können zur Verbesserung der Situation beitragen. Große Einigkeit bei der Bekämpfung von Machtmissbrauch besteht im Abbau der Machtfülle von Professor:innen und der Verringerung der Abhängigkeiten von Mitarbeitenden. Die Trennung von Betreuung und Begutachtung bei Promotionsverfahren wäre ein bedeutender Schritt, der darüber hinaus durch die Einrichtung unabhängiger Komitees zur Begleitung und Dokumentation von Promotionsprozessen Nachdruck finden könnte.
Eine sehr viel weitreichendere Maßnahme ist die Auflösung des Lehrstuhlmodells und die Einführung von Departments. Im Departmentmodell werden Mitarbeitende nicht einzelnen weisungsbefugten Professor:innen zugeteilt, sondern sind dem gesamten Department zugeordnet. Entscheidungen über die Einrichtung von Stellen und Personalangelegenheiten, einschließlich der Einstellung von Mitarbeitenden, Vertragsverlängerungen etc., werden durch Kommissionen auf der Ebene des Departments getroffen.
Genauso erforderlich ist die Stärkung der Unterstützung von Betroffenen und die dringend notwendige Reform der Anlauf- und Beschwerdestellen. Diese müssen dahin gehend verändert werden, dass ihre institutionelle Unabhängigkeit sowie vollständige Vertraulichkeit und Anonymität gewährleistet sind. In dieser Hinsicht findet die Einrichtung externer Beratungs- und Beschwerdestellen, die keiner Weisung von Hochschulen unterliegen, breite Zustimmung.
Neben solchen grundlegenden Strukturveränderungen gibt es zahlreiche kleinere Stellschrauben, um Machtmissbrauch zu begegnen. Beispiele hierfür sind die regelmäßige Thematisierung von Machtmissbrauch auf den unterschiedlichen Ebenen von Hochschulen sowie die Stärkung der Unterstützung von Betroffenen durch leicht zugängliche Informationen über Beschwerdestellen, niedrigschwellige Meldewege und die Bereitstellung finanzieller Mittel für externe Beratungsstellen. Viel ist erreicht, wenn Betroffene nicht allein gelassen werden und ihre Erfahrungen gehört und anerkannt werden.
Die Resistenzen gegenüber dem Abbau von Machtmissbrauch sind groß. Verwunderlich ist das nicht. Denn Maßnahmen zum nachhaltigen Abbau von Machtmissbrauch gehen notwendigerweise mit Umgestaltungen zentraler Fundamente einher, auf denen das Wissenschaftssystem seit Langem basiert.
Doch der Missstand wird zunehmend sichtbar. Er ist in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit angekommen, die Stimmen werden lauter, dringlich diesem Missstand entgegenzuwirken und die Initiativen, Machtmissbrauch zu bekämpfen, wachsen. Diesen Prozess gilt es weiter voranzutreiben.
Vielen Dank für das Interview, Frau Professorin Schweppe.
Vita
Prof.in Dr.in Cornelia Schweppe ist Professorin i. R. für Sozialpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören: Transnationalität und Sozialpädagogik, transnationales Alter(n), Migration, Alter(n)s- und Altenhilfeforschung, Armutsforschung, Professionalisierung der Sozialen Arbeit sowie Soziale Arbeit in Lateinamerika. Ihr Buch Machtmissbrauch an Hochschulen ist 2025 Print und Open Access bei wbv Publikation erschienen.
Literatur
Bössel, N., Kluge, A., Leising, D., Mischkowski, D., Phan, L. V., Schmitt, M. & Stahl, J. (2022). Anreizsystem, Machtmissbrauch und wissenschaftliches Fehlverhalten. https://www.dgps.de/fileadmin/user_upload/PDF/Berichte/Bericht_DGPs-Kommission_AMWF.pdf
Dirnagl, U. (o. J.). Coole Chefs, steile Hierarchien: Wie Machtmissbrauch in der Wissenschaft gedeiht, Laborjournal. www.laborjournal.de/rubric/narr/narr/n_25_01.ph.
Leising, D., Winkler, M., & Schade, H. (2025): Macht und Machtmissbrauch in der Wissenschaft. In: Schweppe, C. (Hg.). Machtmissbrauch an Hochschulen, Analysen und Perspektiven, wbv Publikation: Bielefeld, S. 17–42.
Moshagen, M., Hilbig, B. E., & Zettler, I. (2018). The dark core of personality. Psychological Review, 125(5), 656–688. https://doi.org/10.1037/rev0000111.