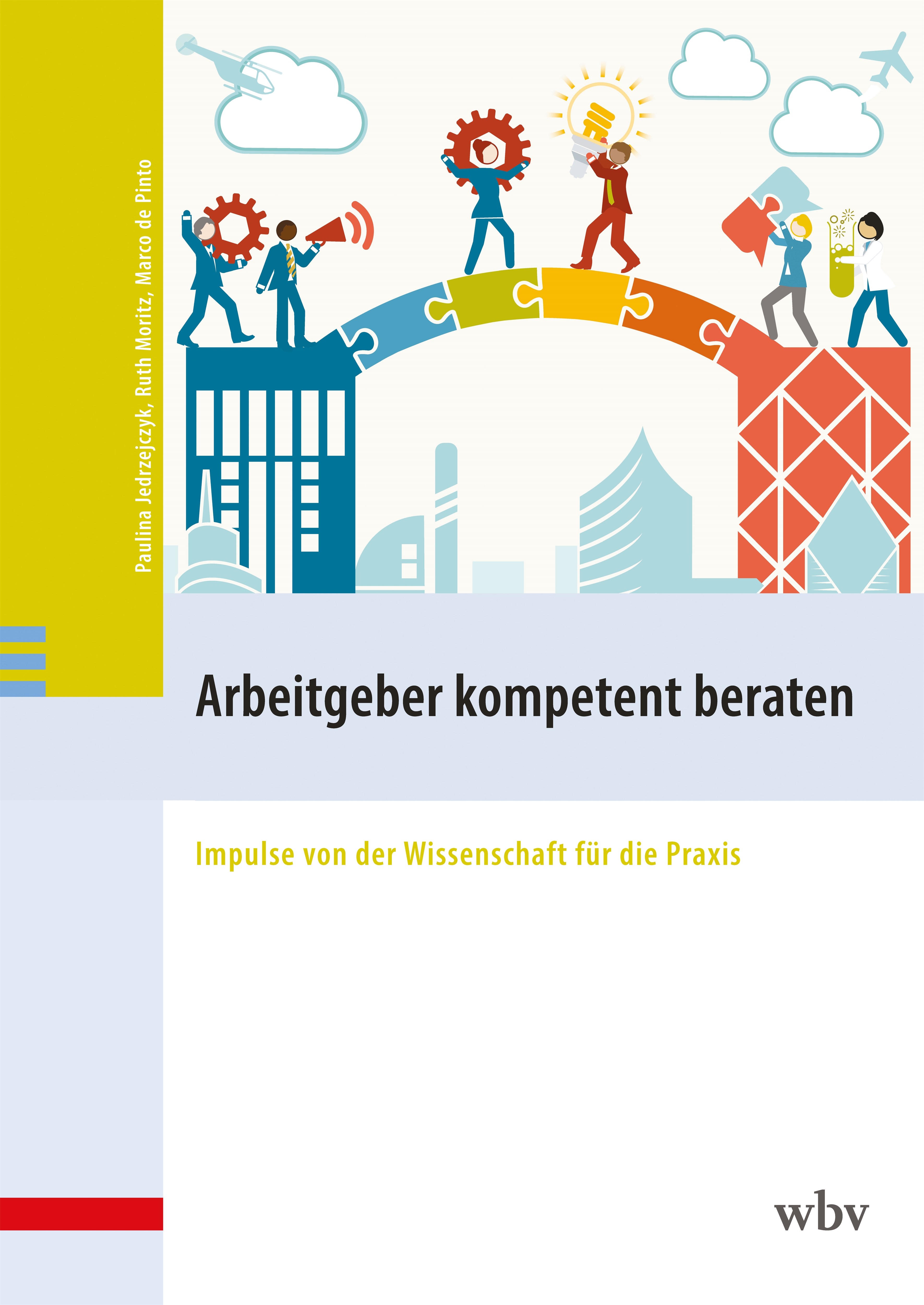Nachdem die Automatisierung die Arbeitswelt grundlegend verändert hat, klopft jetzt Künstliche Intelligenz (KI) an Werktore und Bürotüren – auch in Verlagen! Vernichtet sie Jobs, schafft sie neue oder ordnet sie nur um? Marco de Pinto, Arbeitsmarktökonom und Autor, hat Forschungsergebnisse zur Entwicklung von Arbeitsmarkt und KI für uns zusammengefasst.
Die Automatisierung von Produktionsprozessen, ermöglicht durch rasanten technologischen Fortschritt, zerstört Arbeitsplätze und stellt damit eine große Gefahr für die menschliche Arbeitskraft dar. Solche Aussagen sind in der Öffentlichkeit weit verbreitet, sie halten aber einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand.
Zwar können Arbeitsplätze wegfallen, jedoch sorgt besagte Automatisierung auch dafür, dass neue Jobs entstehen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet halten sich beide Effekte ungefähr die Waage. In der Studie von de Pinto und Zierahn-Weilage (2024) wurde dies klar herausgearbeitet. Richtig ist jedoch, dass sich durch Automatisierung die Struktur des Arbeitsmarktes ändert. Das bringt Gewinner und Verlierer hervor und sehr häufig entscheidet das Qualifikationsniveau von Menschen darüber, zu welcher Gruppe sie gehören. Denn: Geringqualifizierte verlieren tendenziell eher ihre Beschäftigung, verweilen dann länger in Arbeitslosigkeit und müssen durchschnittlich höhere Lohneinbußen bei Folgebeschäftigungen hinnehmen. Hochqualifizierte profitieren dagegen vor allem durch höhere Löhne.
Technologischer Fortschritt hört jedoch bei Automatisierung nicht auf. Ganz im Gegenteil: Die technischen Innovationen werden immer tiefgreifender – das beste und aktuellste Beispiel ist die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI). Und auch hier besteht wieder die Sorge, dass damit das Ende der Arbeit gekommen sei. Mehr noch: Jetzt wird gemutmaßt, dass auch hochqualifizierte Arbeitskräfte um ihre Jobs fürchten müssen. De Pinto und Zierahn-Weilage (2024) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass grundsätzlich ähnliche Mechanismen wirken wie im Falle der Automatisierung.
Wie die KI selbst, schreitet auch die wissenschaftliche Analyse zu ihren Arbeitsmarkteffekten rasant voran. Ein sehr lesenswerter Artikel von Drydakis (2025) fasst die bisherigen Erkenntnisse aus der Literatur zusammen:
- KI schafft neue Berufe und neue Tätigkeitsfelder innerhalb bestehender Berufe mit einem (besonders) hohen Qualifikationsniveau. Hochqualifizierte Personen profitieren in Form einer höheren Arbeitsnachfrage und höherer Löhne, relativ zu Personen ohne diese Fähigkeiten.
- KI zerstört Arbeitsplätze für Geringqualifizierte und beschleunigt die Automatisierung von Routinetätigkeiten. Diese Entwicklung impliziert – in Verbindung mit den positiven Arbeitsmarkteffekten für Hochqualifizierte – eine Erhöhung der Einkommensungleichheit zwischen beiden Gruppen.
- KI hat das Potenzial, die Produktivität des Produktionsfaktors Arbeit im Allgemeinen zu erhöhen, mit potenziell positiven Wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Performance.
Diese Einsichten deuten darauf hin, dass auch für die KI gilt: kein Ende der Arbeit in Sicht. Es scheint vielmehr so zu sein, dass – wie von de Pinto und Zierahn-Weilage (2024) vermutet – KI analog zur Automatisierung Jobs zerstört und gleichzeitig neue schafft, obgleich die bereits durch Automatisierung verursachten strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch KI weiter verstärkt werden.
Es gibt in der Literatur aber vereinzelt Hinweise darauf, dass KI eine neue strukturelle Anpassung hervorruft, und zwar dadurch, dass nun auch hochqualifizierte Personen zu den Verlierern (Lohneinbußen, sinkende Beschäftigungssicherheit) gehören. Der Grund dafür ist, dass KI in der Lage ist, auch nicht-routinemäßige Tätigkeiten durchzuführen. Die durch die KI geschaffenen neuen Tätigkeitsprofile wirken dem zwar entgegen, erfordern aber auch höchste, KI-kompatible Kompetenzen, über welche nicht alle hochqualifizierten Personen verfügen (vgl. z. B. Minniti et al. 2025, Gathmann et al. 2024).
Die Arbeitsmarktpolitik steht vor der großen Herausforderung, den strukturellen Änderungen so zu begegnen, dass möglichst viele der Verlierer aufgefangen werden und durch entsprechende Maßnahmen zu den Gewinnern aufschließen können. Weiterbildungen in Form von Re- oder Up-Skilling-Programmen sind hier ein Schlüsselinstrument. Allerdings könnten viele Bemühungen der Arbeitsmarktpolitik in den Kinderschuhen stecken bleiben, wenn Unternehmen als Arbeitsnachfrager nicht entsprechend mit ins Boot geholt werden. Die Arbeitgeberberatung könnte hier einen wesentlichen Beitrag leisten.
In dem Sammelband „Arbeitgeber kompetent beraten“ von Jedrzejczyk, Moritz und de Pinto (2024) finden sich hierzu einige Impulse aus der Wissenschaft. Thematisiert wird z. B. ein modernes Recruiting in Zeiten von KI, die betriebliche Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Beachtung regionalspezifischer Gegebenheiten. Im Allgemeinen wird es in Zukunft verstärkt darum gehen, Unternehmen dafür zu sensibilisieren, dass der Einsatz von KI in den meisten Bereichen zum Alltag gehören wird. Nicht auf diesen Trend zu setzen, würde erhebliche Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. KI transformiert – wie erörtert – den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft, ersetzt sie aber nicht.
Wie Kollege Prof. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB es treffend in seinem LinkedIn-Post vom 03.07.2025 formulierte: „(…) Arbeit ändert sich: Es geht um inhaltlich flexibles, selbstorganisiertes Arbeiten, Abstraktionsfähigkeit, Lernfähigkeit, Kommunikationskompetenz. KI kann neue Geschäftsmodelle und Arbeit bedeuten, nicht nur Ersetzen menschlicher Tätigkeiten! (…) KI kann Wohlstand erhöhen, aber um Fachkräfte und Qualifizierung müssen wir uns kümmern!“ (Weber, 2025).
Prof. Dr. Marco de Pinto ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Arbeitsmarktökonomik an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Er forscht und lehrt zur Arbeitsmarkttheorie und -politik, mit Fokus auf den Arbeitsmarktwirkungen von Globalisierung, Arbeitsmarktinstitutionen und Digitalisierung. Zusammen mit Paulina Jedrzejczyk und Ruth Moritz ist er Herausgeber des Bandes "Arbeitgeber kompetent beraten", der wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis transferiert.
Literatur:
Gathmann, Christina, Felix Grimm, Erwin Winkler (2024): AI, Task Changes in Jobs, and Worker Reallocation, cesifo Working Papers, Nr. 11.585.
Minniti, Antonio, Klaus Prettner und Francesco Venturini (2025): AI innovation and the labor share in European regions, European Economic Review, 177.
Drydakis, Nick (2025): Artificial intelligence and labor market outcomes, IZA World of Labor, 514.
de Pinto, Marco und Ulrich Zierahn-Weilage (2024): Arbeitsmarkteffekte der Automatisierung – eine ökonomische Perspektive. In: Jedrzejczyk, Paulina; Moritz, Ruth & de Pinto, Marco (Hg.), Arbeitgeber kompetent beraten: Impulse von der Wissenschaft für die Praxis. Bielefeld: wbv Publikation.
Jedrzejczyk, Paulina, Ruth Moritz und Marco de Pinto (Hg.) (2024): Arbeitgeber kompetent beraten: Impulse von der Wissenschaft für die Praxis, Bielefeld: wbv Publikation.
Weber, Enzo (2025): o. T., LinkedIn, 03.07.2025, URL: https://www.linkedin.com/posts/enzo-weber_arbeitsmarkt-plusminus-ki-activity-734643919130974